Lesetipps von Hornby bis WelshBuchtipps, die einem die Zeit zu Hause verschönern

Mit Lesen können wir jetzt viel Zeit verbringen.
Copyright: Getty Images/Westend61
- Was tun mit der ganzen Zeit daheim? Wir sagen - endlich mal wieder gute Bücher lesen!
- Hier finden Sie 18 Lesetipps und Rezensionen für die kommenden Wochen. Ob Krimis, Romane oder Sachbücher, alles ist mit dabei.
- Gerade das Lesen von Autorinnen und Autoren, die eigentlich bei der Lit.Cologne gewesen wären, tröstet über die abgesagten Veranstaltungen hinweg.
- Tipp: Erkundigen Sie sich bei Ihrem lokalen Buchhändler, ob eine Online-Bestellung möglich ist!
Aktuell verbringen wir so viel Zeit drinnen wie selten im Frühling - und angesichts der aktuellen Ansteckungslage im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist das auch richtig so. Doch was tun mit all der (gezwungenermaßen) freien Zeit? Netflix ist schon „leer“ geschaut, alle neuen Podcast-Folgen gehört, und die immer gleiche Playlist dudelt seit Stunden rauf und runter? Dann schnappen Sie sich doch mal wieder ein richtig gutes Buch und verziehen sich auf ein sonniges Plätzchen in Ihrer Wohnung. Durch eine Buchbestellung können Sie aktuell außerdem gebeutelten Einzelhändlern unter die Arme greifen. Erkundigen Sie sich doch telefonisch oder über das Internet bei Ihrem lokalen Buchhändler, ob dieser Bestellungen entgegennimmt und liefert.
Beispielsweise die beliebte Buchhandlung Klaus Bittner nimmt Aufträge über ihre Webseite oder per E-Mail entgegen und bringt Ihnen die Bücher bis vor die Haustür! Demnach steht dem Schmökern also nichts mehr im Wege. (awe)
Krimi-Tipps in Kürze

Copyright: Scherz Verlag
- Unter der Erde:
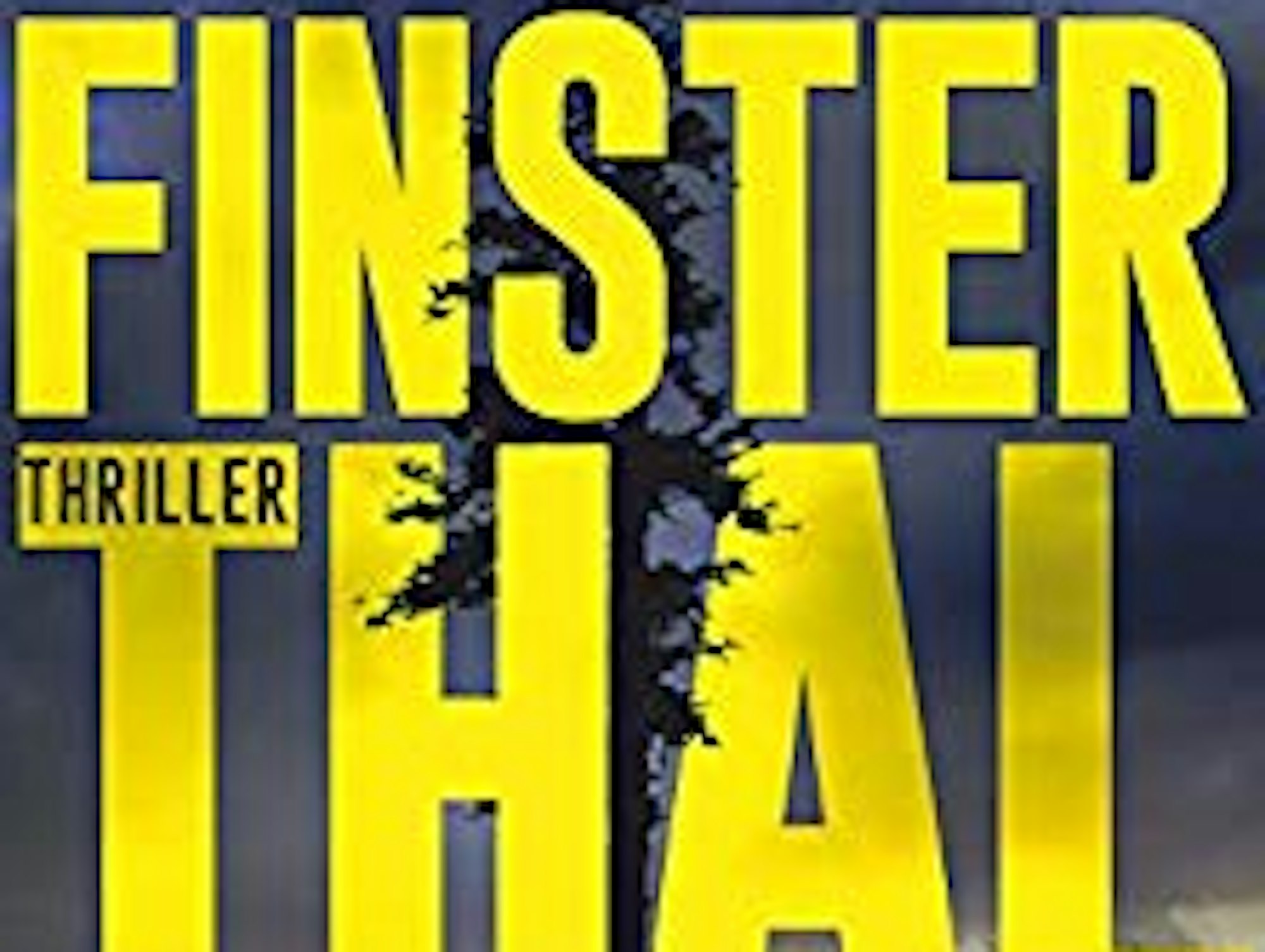
Copyright: dtv Verlag
- Finsterthal:
Ausführliche Besprechungen
Je tiefer das Wasser
Seelisch vergiftet Raffiniert und radikal: Ein Romandebüt über die Abgründe einer Familie.
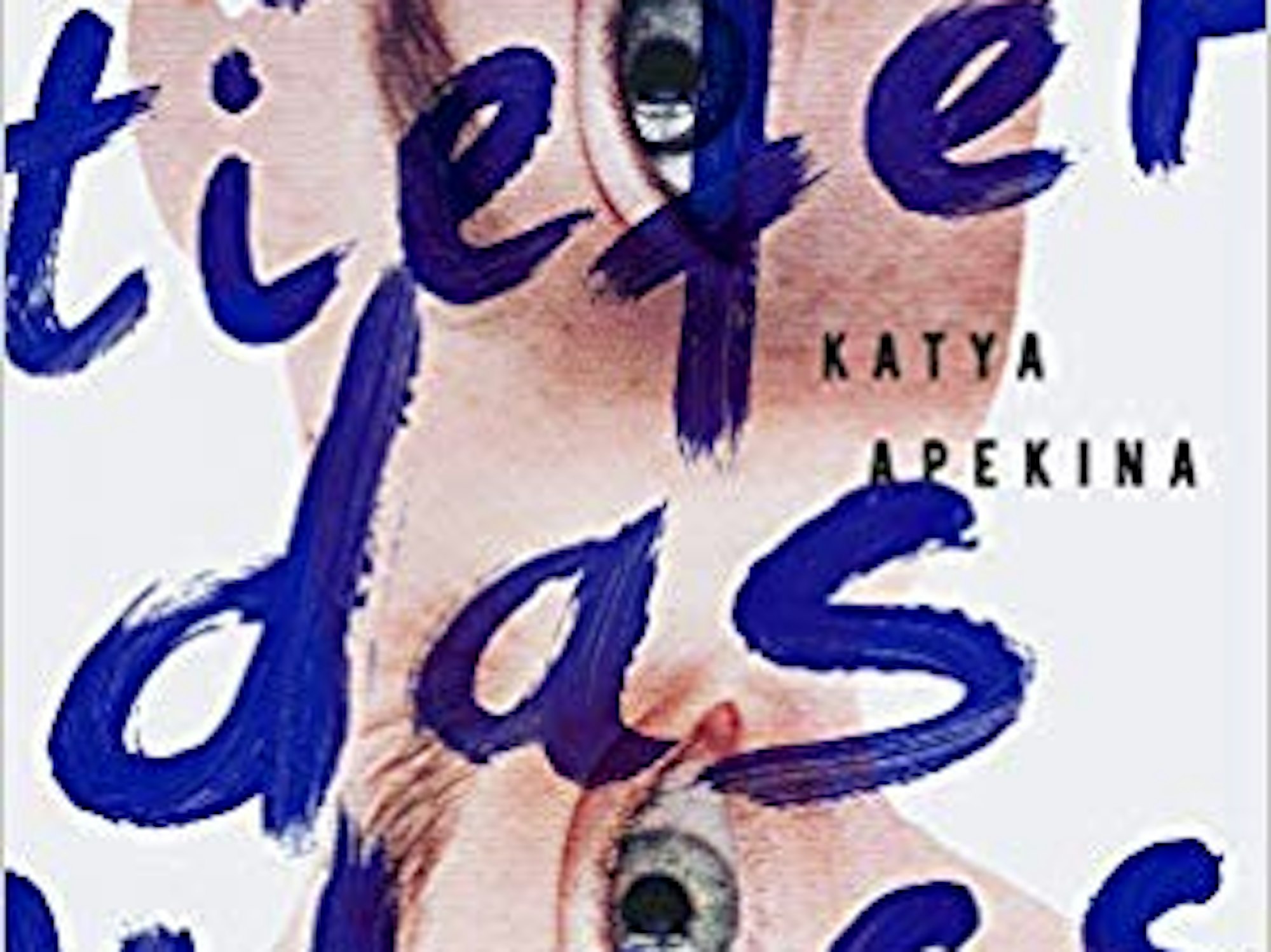
Copyright: Suhrkamp Verlag
Manchmal denke ich, wir sind in verschiedenen Familien aufgewachsen.“ Mae sagt dies zu ihrer Schwester Edie und trifft damit den Nerv dieses verstörenden Familienromans. Eigentlich leben die halbwüchsigen Mädchen bei ihrer Mutter Marianne in Louisiana, doch nach deren gescheitertem Selbstmordversuch werden sie 1997 nach New York verpflanzt, zu ihrem schon vor Jahren abtrünnigen Vater Dennis Lomack.Der Starschriftsteller gibt sich entzückt über die Ankunft der Töchter, die sich indessen bald in feindlichen Lagern wiederfinden. Edie lässt Dennis bei jeder noch so gut gemeinten Annäherung abblitzen, wittert sie darin doch Verrat an der Schmerzensmutter. Ganz anders Mae. Sie verabscheut das radikale Getue der Mutter, das ihr so gekünstelt und übertrieben vorkommt, „als wäre sie eine scheiß Sylvia Plath“. Dass Marianne gerade in der Psychiatrie liegt, kommt ihr sehr entgegen, denn sie wünscht sich „Mom vakuumversiegelt an einem Ort, wo sie uns nicht erreichen konnte“.
Die in Moskau geborene, schon als Kind mit den Eltern in die USA gekommene Katya Apekina hat ihr Romandebüt „Je tiefer das Wasser“ in einem Kleinstverlag publiziert und Furore gemacht. Kein Wunder, denn raffinierter und radikaler kann man dem Leser kaum den Boden unter den Füßen wegziehen. Diese Autorin denkt gar nicht daran, aus allwissender Vogelschau Schiedsrichterin ihrer Figuren zu spielen. Vielmehr lässt sie jeder ihre eigene Perspektive.
Da ist etwa Dennis Schwester Rose, die nicht den leisesten Zweifel daran hegt, dass ihr Bruder in dieser desaströsen Ehe das Opfer war. Doch es gibt andere Stimmen. Sein schwarzer Kommilitone Fred, mit dem Dennis 1961 in die Südstaaten ging, um an den Protesten gegen den dortigen Rassismus teilzunehmen. Beide wurden übel verprügelt, und die Freundschaft zerbrach, als Fred sich in Lomacks Erfolgsroman „Yesterday’s Bonfires“ wiederfand.Für Fred steht fest, dass Dennis „ein emotionaler Vampir“ war, der auch die sehr viel jüngere, höchst labile Marianne als Treibstoff für seine Literatur brauchte. Apekina schafft es, dass man sich immer unsicherer fühlt, je mehr Steinchen ihres Psycho-Mosaiks sie auf den Tisch legt. Es gibt entlarvend wirre Selbstzeugnisse Mariannes, aber auch ein warnendes Schreiben ihres Vaters an den Bräutigam: „Du verdienst es, glücklich zu sein, aber nicht mit meiner Marianne. Du wirst ihr wehtun, und ich will dich nicht in ihrer Nähe wissen.“
Letztlich geht es der in Los Angeles lebenden Schriftstellerin aber gar nicht um größere oder geringere Schuld. Sie zeigt zwei Menschen, die dazu bestimmt waren, einander unglücklich zu machen und dabei auch noch die Kinder seelisch zu vergiften. Edie brennt schließlich mit dem virilen Stotterer Charlie durch, um die Mutter zu entführen. Doch das gefährlichere Spiel wagt ihre Schwester. Mae spürt, wie sehr Dennis Marianne vermisst und wie leicht sie in die Rolle dieser Kindfrau schlüpfen kann. Die Tochter gibt die Zweitbesetzung ihrer Mutter, was bis an die Grenze des inzestuösen Tabubruchs führt. Es wird Flammen geben, ein verbranntes Manuskript, unsägliche Schmerzen und eine bittere Erkenntnis: „Kunst ist ein Messer. Du musst bluten.“ Mae blutet, aber sie lernt auch, die Kunst für sich zu benutzen. Über ihre riskante Vaterliebe und deren katastrophale Folgen dreht sie den Film „Flächenbrand“, dessen Titel nicht übertrieben ist. Das Schlusskapitel klingt nach all diesen Liebesverschwendungen fast irritierend tröstlich. Zeigt es doch, was Mae und Edie auch sind: Überlebenskünstlerinnen. Hartmut Wilmes
Katya Apekina: „Je tiefer das Wasser“, deutsch von Brigitte Jakobeit, Suhrkamp, 396 Seiten, 24 Euro, E-Book: 20,99 Euro.
Serpentinen
Der Horror unserer Herkunft. Sarkastischer als der Bestseller „Auerhaus“ – aber genauso grandios.
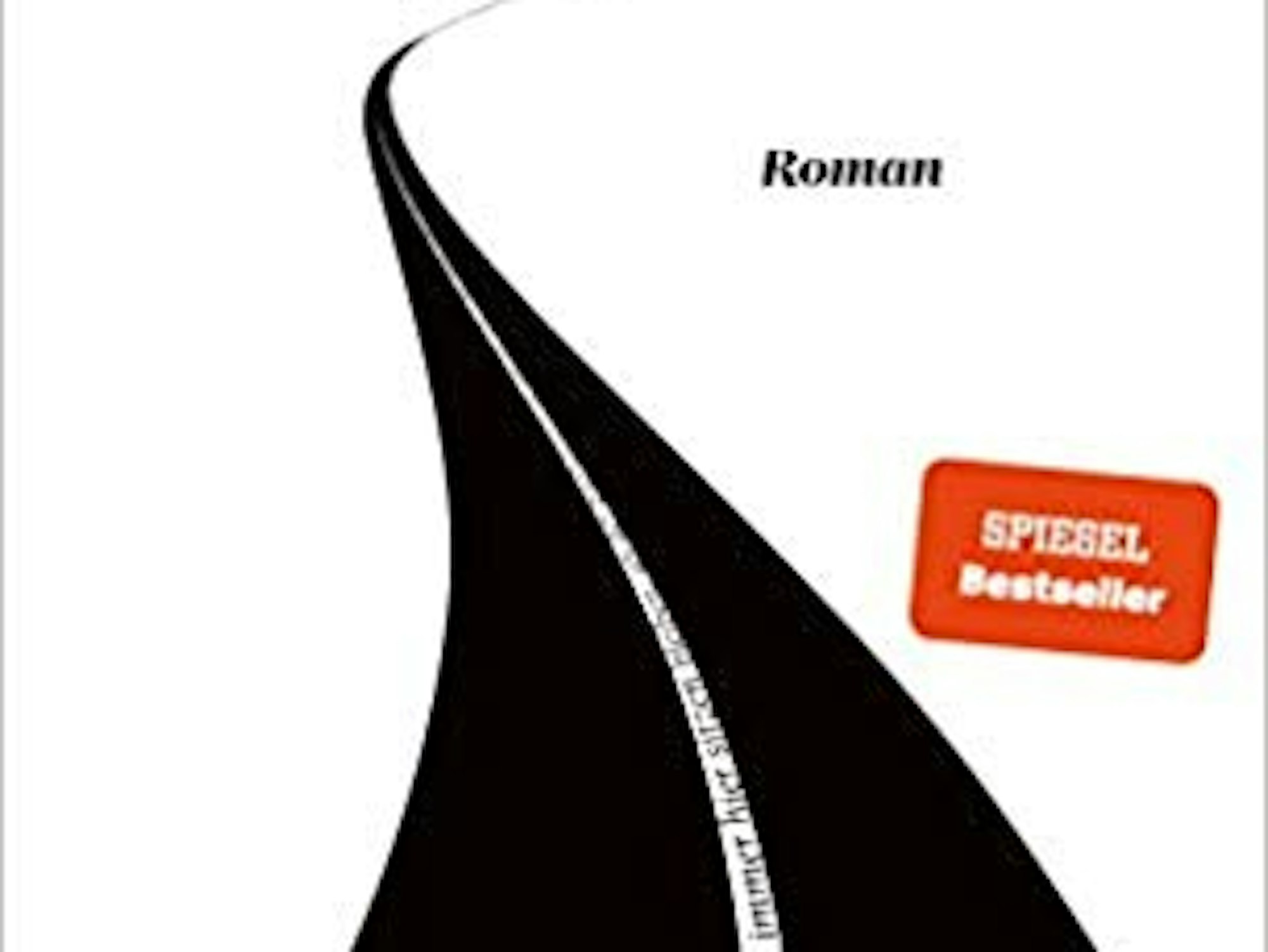
Copyright: Claassen Verlag
Die Philosophin und Psychoanalytikerin Julia Kristeva nannte die Depression einst in einer Studie die „Schwarze Sonne“. Für den Ich-Erzähler von Bov Bjergs neuem Roman „Serpentinen“ ist sie der „Schwarze Gott“. Der Dämon beherrscht den Ich-Erzähler immer stärker. „Urgroßvater, Großvater, Vater. Ertränkt, erschossen, erhängt. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft“, heißt es gleich zu Beginn des Romans. Eine ganze Ahnenreihe von Selbstmördern. Jetzt scheint der Ich-Erzähler an der Reihe. Nur will er die unselige Erbfolge unterbrechen, will seinem siebenjährigen Sohn das Leid ersparen, das er selbst durch den Selbstmord seines Vaters erfahren hat. Er will ihn mit sich in den Tod nehmen. Abraham opfert Isaak dem Schwarzen Gott: „Die Tradition war hier zu Ende. Der Junge würde nicht ohne Vater sein, und er würde keinen Sohn haben, der ohne Vater war. Und sein Sohn würde keinen Sohn haben, der ohne Vater war. Und. Das war die Auslöschung.“
Eine ungeheuerliche Ausgangslage, mit der Bov Bjerg seine Leser konfrontiert. Mit ungeduldiger Nervosität, als wäre es ein Thriller, verfolgt man die Unternehmungen des Vaters mit seinem Sohn. Er nimmt ihn mit auf eine Reise in seine Vergangenheit, eine Kindheit in der Schwäbischen Alb. Es geht die titelgebenden Serpentinen hinauf und hinunter - Metapher für die Seelenlagen des gebeutelten Erzählers. Vater und Sohn blicken auf idyllische Provinzlandschaften. Sie besuchen Kirchen, auch einen Friedhof, auf dem ein Freund des Erzählers namens Frieder begraben sein soll - ein ironischer Verweis von Autor Bov Bjerg auf seinen vorherigen Roman „Auerhaus“. Mit der humorigen Geschichte über ein schwieriges Erwachsenwerden und den suizidalen Teenager Frieder landete Bjerg vor drei Jahren einen Bestseller. Das Buch ist Schullektüre, wurde von Theatern wie auch vom Kino adaptiert. „Serpentinen“ ist ein sarkastischerer Nachfolger.
Der Ich-Erzähler, eigentlich ein erfolgreicher Soziologieprofessor, braucht viel Bier, um den Selbstekel zu betäuben. Er verachtet sich dafür, seinen eigenen Maßstäben als Vater nicht gerecht zu werden. Und für seine Herkunft. Wenn der Ich-Erzähler von seinem Gefühl erzählt, als Arbeiterkind immer ein Paria in der Akademiker-Elite zu sein, scheint er wie eine Kopie des französischen Soziologen Didier Eribon, der in „Rückkehr nach Reims“ sehr präzise dieses Phänomen der unüberwindbaren Milieu-Prägungen analysiert hat.
„Um was geht es?“, fragt das siebenjährige Kind im Roman immer wieder mit unschuldiger Penetranz den mit seinen inneren Dämonen ringenden Vater. Um eine große Frage, müsste dieser antworten: Wie können wir den Horror unserer Herkunft, unsere seelischen Beschädigungen überwinden, damit wir sie nicht an die Kinder weitergeben? In knappen, harten Sätzen umkreist der Autor die familiären wie historischen Traumata: Die gewalttätigen, versoffenen Nachkriegsväter. Die Nazi-Kontinuitäten in der Bundesrepublik. Die aus dem Osten vertriebenen Großeltern. Und eine Gegenwart als Resultat dieser desaströsen Vergangenheiten. Mit präzisem Gespür montiert Bov Bjerg die Zeiten ineinander. Er deutet an, bricht Anekdoten ab, greift die Gedankenfäden des Ich-Erzählers wieder auf und spiegelt die individuelle Geschichte in der Familien-, Gesellschafts-, ja sogar Erdgeschichte. Dabei wahrt er klug skeptische Distanz zur Weltsicht seines Ich-Erzählers, seiner pessimistischen Determinismus-Obsession.
Gibt es den genetisch vererbten Suizid-Zwang, die unabänderliche Genealogie der Depression? Der Exorzismus des „Schwarzen Gottes“ - er ist heftig und schmerzhaft. Wie dieser grandiose Roman. Nicole Strecker
- Bov Bjerg:
Der freie Hund
Wohlfühl-Krimi mit Tiefgang. In Wolfgang Schorlaus neuem Roman wird Venedig zum Tatort.

Copyright: Kiepenheuer&Witsch Verlag
Ein Sizilianer in Venedig? Das kann nicht gut gehen. Zu viele Touristen, zu viele Kanäle. Zu wenig Straßen. Zu wenig Luft zum Atmen. Widerwillig schiebt sich Commissario Antonio Morello, aus dem sizilianischen Cefalu zwangsversetzt in die angeblich schönste Stadt der Welt, an seinem ersten Arbeitstag durch enge Gassen und überfüllte Plätze, entschlossen, nichts, aber auch gar nichts schön zu finden an seiner zukünftigen Arbeitsstätte.
„Wo war er hier hingeraten? Das Wasser ist nicht tief, trotzdem kann er nicht bis auf den Grund sehen. Die Brühe ist undurchdringlich – und sie stinkt. Angewidert geht er weiter. In den Wellen schaukelt eine alte Zeitung. Die Strömung versucht vergeblich, die Titelseite umzublättern. Daneben treiben eine Plastikflasche und ein gebrauchtes Kondom.“ Dass seine venezianischen Kolleginnen und Kollegen wenig begeistert sind vom neuen Chef der Abteilung für Gewaltverbrechen – geschenkt. Morello, der „faule Sizilianer aus dem tiefsten Süden“, gedenkt nicht, lange im Drecksloch Venedig zu bleiben. Was sich als frommer Wunsch erweisen könnte.
„Der freie Hund“, Commissario Morellis erster Fall, ist das Auftakt zu einer neuen Reihe von Krimiautor Wolfgang Schorlau. Der hat sogar einen echten Sizilianer mit ins Boot geholt. Als Co-Autor fungiert der Drehbuchschreiber und Schauspieler Claudio Caiolo aus Sant’Agata di Militello. Schon an seinem zweiten Tag in Venedig wird Morello ins kalte Wasser geworfen. Francesco Grittieri, ein Sohn aus reichem Haus und engagierter Gegner der Kreuzfahrtschiffe, die Venedig jährlich zu Hunderten heimsuchen, ist erstochen worden. Unter Verdacht: sein Freund und Mitkämpfer Pietro Rizzo. Hat Francesco ihm doch die Partnerin ausgespannt. Auch politisch waren die Freunde oft unterschiedlicher Meinung. Doch Morello glaubt nicht an die Schuld des bulligen jungen Mannes. Er, der Sizilien verlassen musste, weil er der Mafia zu nahegekommen ist, hat einen ganz anderen Verdacht: Auch hinter diesem Fall könnte das organisierte Verbrechen stecken.
Bislang war Schorlau, Jahrgang 1951, vor allem bekannt als Autor von spannenden Politkrimis. In seiner Reihe um den ehemaligen BKA-Mann Georg Dengler beschäftigt er sich vorwiegend mit den kriminellen Machenschaften der Pharmaindustrie, mit Rechtsradikalen und Geheimorganisationen in Deutschland. Auch in seiner neuen Reihe bleibt er sich treu – obwohl „Der freie Hund“ auf den ersten Blick an die weichgespülten Kriminalromane von Donna Leon und Martin Walker erinnert. Da wird gekocht und geschlemmt, die Rezepte gibt es gleich dazu. Das kennt man von Walkers vielfach durchgenudeltem Protagonisten Bruno. Donna Leons Commissario Brunetti lässt ebenfalls grüßen. Morello teilt mit ihm die Vorliebe für Bars, Cafés und einen guten Cappuccino. Mit seiner schönen Nachbarin bummelt er durch Venedig und lässt sich von ihr die Stadt zeigen. Die so ausführlich beschrieben wird, dass man geneigt ist, die ein oder andere Seite zu überblättern.
Doch schon bald entwickelt sich auch dieser Wohlfühl-Krimi aus dem Lieblingsreiseland der Deutschen zu einer knallharten und spannenden Politstory, in der es um Korruption und illegalen Kunsthandel geht. Natürlich hat die Mafia ihre Hände im Spiel. Etwas anderes anzunehmen wäre blauäugig, wie Morello seinen neuen Kollegen unter Einsatz seines Lebens vor Augen führt. Man darf also auf die Fortsetzung der Kooperation Schorlau-Caiolo gespannt sein. Denn dass der Kommissar noch eine Weile in Venedig bleiben wird, steht schon jetzt außer Frage. Petra Pluwatsch
- Wolfgang Schorlau, Claudio Caiolo:
Der Hund
Wahnsinnig lecker. Rauschhaft und roh: Akiz’ Debüt zeigt einen Koch zwischen Genialität und Irrsinn.

Copyright: hanserblau Verlag
Der Hund ist ein Mensch. Ein Waisenjunge aus dem Kosovo, aufgewachsen unter einer Luke in einem Erdloch, so erzählen sie es sich. Kein Licht, keine Gespräche. Nur Essen. Manchmal schoben sie ihm Brot, Bohnen oder Kartoffeln hinein. Manchmal auch Hühnerfleisch. Und so lernte der Hund, die Welt zu schmecken.
Er lernte aus dem Abfall der Gesellschaft noch Gerichte zu kochen, die so gut sind, dass sie wie Drogen wirken, dass sie „die Hormone wie aufschäumende Brause ins Blut“ schießen lassen. So beschreibt es der Erzähler, als er das erste Mal eine Kreation des Hundes – angebratener Tabak mit halbverbrannten, in Wodka getränkten Brotkrümel – kostet. Sie arbeiten zusammen in einem ranzigen Dönerimbiss gegenüber des besten Restaurants der Stadt, dem El Cion. Der Erzähler ist ein gescheiterter Rotisseur, der Hund ist einfach da. Viel erfährt man nicht über ihn, was auch daran liegen mag, dass er nicht spricht. Bis Seite 59 lässt Autor Akiz alias Achim Bornhak den Hund kein einziges direktes Wort sagen. Und dann nur eins: „Nichts.“
In einer grotesken Welt, die Akiz in seinem ersten Roman von der Haute Cuisine und ihren Protagonisten zeichnet, steigt der Hund zwischen Chefköchen, die ihren Gästen die Zähne ausschlagen, weil die das Essen zurückgehen ließen und Mitarbeitern, die in der Vorratskammer ihres Sternerestaurants das Ritalin mit ihren Küchenmessern zerhacken, zum Starkoch auf. Die Sprache passt dabei zur erdachten Szenerie, alles, wirklich alles in Akiz’ Welt ist düster, verkommen, extrem. Kaum eine Seite kommt ohne Schimpfwörter aus, kaum eine Handlung ohne einen bedeutungsschweren Vergleich. Ein Fernsehmoderator darf nicht einfach Fernsehmoderator sein, sondern er ist ein „arschgefickter“ Fernsehmoderator. Der Mond darf nicht einfach scheinen, so wie jeder Mensch ihn bereits scheinen gesehen hat. Stattdessen kippt er „rund und schwermütig sein rotes Licht wie glühenden Brei hinunter auf die dunklen Dächer“.
Während die Geschichte des Hundes wirklich eine neue ist, keine, die man so schon einmal gelesen hat, nicht mal in ein Genre passend, irgendwie Horror, Fantasy, Thriller, Komödie zugleich, ist Akiz’ Sprache manchmal große Stärke, seltener zwar, aber nicht zu selten, auch die Schwäche der Erzählung. Schafft sie manchmal eine wunderbare zweite Ebene, um die durchgeknallten Figuren besser zu verstehen, etwa wenn Akiz über den alternden Superkoch Valentino schreibt, „dass er die Wochentage nur noch auseinanderhalten könne, wenn er die Beschriftung auf den Fächern seiner Pillendose“ liest, nimmt sie oft auch einen Umweg zu viel. Etwa wenn hungrige Köche als „ausgemergelte Wölfe mit stumpfem Fell und verzweifelten Augen“ beschrieben werden. Sprachliche Schlenker ohne große Funktion, außer dass sie einmal mehr das Gefühl nähren, von dem der Leser wirklich schon genug verspürt: Unbehagen.
Das löst sich auch bis zum Ende nicht auf, „Der Hund“ bleibt trotz mehreren Siedepunkt-Momenten ein rohes Buch. Der Rausch, der anfangs die Menschen befällt, wenn sie von seinen Gerichten kosten, entwickelt sich über 192 Seiten zum Wahn. Erzählperspektiven und Wahrheiten zerfließen. Teilweise fühlt es sich an, als würde man Gedächtnisprotokolle eines Junkies lesen, als wäre die ganze Geschichte nur ein einziger großer Trip. Dabei zeigt Akiz, der vor seinem Buchdebüt als Regisseur bekannt geworden ist, wie frei und klug er mit Realität hantieren kann. So lässt er einen Leser zurück, der selbst entscheiden muss, ob er den Schluss des Romans so glauben kann. Und macht ihn damit selbst zu einer einzigen großen Metapher. Jonah Lemm
- Akiz:
Stern 111
Als Mitte noch Möglichkeitsraum war. Lutz Seiler knüpft mit „Stern 111“ an seinen Erfolgsroman „Kruso“ an.

Copyright: Suhrkamp Verlag
Und plötzlich, ziemlich genau in der Mitte von Lutz Seilers zweitem Roman „Stern 111“, fliegt die Ziege. Dodo heißt das Tier, gehört einem Hausbesetzer in Berlin-Mitte, den alle nur den Hirten nennen. Weil er das Rudel, wie sich die Illegalen aus der Oranienburgerstraße nennen, mit halb kryptischen, halb visionären Sätzen anleitet. Oder auch Hoffi. Weil er so voller Enthusiasmus und Hoffnung ist. „Dodo begann“, schreibt Seiler, „langsam zu steigen, zentimeterweise. Zuerst streichelte der Hirte sie noch, dann ließ er von ihr ab. Alle starrten auf die Ziege. Das Tier schwebte jetzt auf halber Höhe, hoch genug, um Hoffi direkt ihn die Augen zu blicken, erst ihm und dann jedem Einzelnen im Keller.“
Es sind die Umbruchjahre 1989/90, die wirre Zeit zwischen dem Ende der DDR und der deutschen Wiedervereinigung. Eine Zeit, in der sich die Verhältnisse in einem Schwebezustand befinden. In der, nur für einen Moment, einfach alles möglich scheint. Sogar eine fliegende Ziege. Der Mittzwanziger Carl Bischoff ist eher zufällig in die Gesellschaft des Rudels geraten, als er kurz vor Weihnachten ’89 frierend und fiebernd zwei Männern in einem geheimen Raum hinter der Leinwand eines Kinos gefolgt war. Eigentlich sollte er gar nicht in Berlin, sondern in Gera sein, die elterliche Wohnung hüten. Die Eltern hatten ihn, den gelernten Maurer und verkrachten Studenten, um Hilfe gebeten und erklärt, jetzt, wo die Grenzen offen seien, noch einmal von vorne anfangen zu wollen, im Westen. Genauer wollten sie den Sohn nicht in ihre Pläne einweihen.
Lange hat es der Zurückgelassene jedoch nicht in der tristen Wohnung ausgehalten, so ganz ohne Träume oder Perspektive. Er hat Effi (wie Briest), dem Mädchen, in das er sich schon in der achten Klasse verguckte, einen Liebesbrief geschrieben, war in den Shiguli seines Vater gestiegen, einen russischen Nachbau des Fiat 124, und ohne Plan, außer dem vermessenen Wunsch, Dichter zu werden, in die große Stadt gefahren.
Zu weiten Teilen erzählt der etablierte Lyriker Seiler in „Stern 111“ seine eigene Geschichte – der Titel verweist übrigens auf ein DDR-Transistorradio – oder nutzt zumindest autobiografische Motive, wie er das bereits in seinem vielgelobten, mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Romandebüt „Kruso“ (2014) tat. Dessen Titelheld Alexey Krusowitsch hat auch im neuen Roman, der zeitlich beinahe nahtlos an den ersten anknüpft, ein paar Gastauftritte – als halbverrückter Commandante, der mit militanter Akribie einen Guerillakampf der Hausbesetzer gegen den neuen Staat plant.
Man darf „Stern 111“ einen Wenderoman nennen und sicher auch einen Coming-of-Age-, oder, altmodischer, Bildungsroman, auch wenn beides reichlich abgegriffen klingt. Was Seilers knapp 530 Seiten starkes Buch aber ausmacht, ist die traumhafte Genauigkeit der Beobachtung: Wie unter dem Brennglas betrachtet der Autor eine Zeit, in der die alten Regeln nicht mehr und die neuen noch nicht gelten, in der einige Menschen sich der Illusion hingeben können, ihr Leben nach eigenen Gesetzen gestalten zu können – und sei es nur für ein paar Monate. „Traumhaft“ beschreibt auch die fast unmerklichen Übergänge, mit denen Seiler von der allwissenden in die von geradezu törichter Ahnungslosigkeit geprägte Erzählperspektive Carls schlüpft, und weiter in diejenige der überaus patenten, aber auch schwer geprüften Mutter des lebensuntüchtigen Dichters.
Wie die Mutter und, in geringerem Ausmaß, der Vater ihre westdeutsche Odyssee erleben, wie sie von syrischen Immigranten und amerikanischen Soldaten selbstverständlich aufgenommen, von überforderten BRD-Bürgern aber mit Verwunderung und Misstrauen betrachtet werden – das wirft Schlagschatten auf das gefühlt immer noch getrennte Land von heute. Nicht anders im Osten Berlins, wo Carl sich endlich überwunden hat, sein „Begrüßungsgeld“ von der Sparkasse abzuholen und von der Bäckersfrau, als er eine West-Münze auf den Tresen legt, angeraunzt wird: „Dat nehm Se mal zurück, junger Mann, dat kommt vom andern Stern.“
An dieser Stelle sei dem Rezensenten eine persönliche Bemerkung gestattet: Ich habe Romane über französische Adlige, argentinische Gauchos oder Comics über jedes physikalische Gesetz übertretende Superhelden gelesen, die mir weitaus weniger exotisch vorkamen. Nicht, dass der Autor übertriebe. Im Gegenteil, Lutz Seiler erfasst mit wirklich staunenswerter Genauigkeit Alltag und Lebensgefühl des Ostens beziehungsweise dass, was daran eigen, bemerkens- und bewahrenswert ist. Ein Volk von Brüdern und Schwestern, das sich nach 40-jähriger Trennung partout nicht mehr wiedererkennt (oder wiedererkennen will) – klingt das nicht wie ein Märchen?Und doch geht es in „Stern 111“ nie um Ostalgie, sondern viel mehr um die besondere Situation, in der Menschen einander wiederfinden, deren Nation im Begriff ist, sich aufzulösen. Märchenhaft ist allein der Möglichkeitsraum, der sich da plötzlich für sie öffnet. Seilers (Rück-)Blick darauf aber, sowohl auf die Anarchos von Berlin-Mitte und Prenzlauer Berg wie auf die Aussiedler im Westen, ist ungetrübt von Sentiment.
Der Spätentwickler Carl wird mehr und mehr zu einem Teil des Rudels – sie nennen ihn den „Shigulimann“ –, zu einer Type wie der Hirte, die fellmützentragende Ragna oder der trinkfeste Hans, der es vom Toilettenmann zum Schauspieler zum Barbetreiber gebracht hat. Auch Carl kellnert jetzt in der „Assel“, dem Versammlungsort der Hausbesetzer, der sich nach und nach in ein Szenelokal verwandelt, frequentiert von Anwohnern, Arbeitern, Straßenstricherinnen und russischen Soldaten, die sich in einer ganz ähnlichen Zwischenwelt befinden. Und er kommt tatsächlich mit Effi, seiner Jugendliebe, zusammen. Zumindest hält er bis zuletzt an der Illusion vom glücklichen Paar fest.
Ob das alles – die Freiheit, die Hoffnungen, die Visionen von einem anderen Leben – letztlich nur Illusion ist, das ist die Frage, um die „Stern 111“ immer engere Kreisbahnen beschreibt. Am Ende, Jahrzehnte später, kehrt Carl – oder ist es der Erzähler? –noch einmal in die Oranienburger Straße zurück. Wo einst ein neues Leben erträumt wurde, steht heute eine Art Design-Showroom: „Einen Kunden oder Verkäufer habe ich nie dort gesehen – keine Menschen, nur ein Kasten aus Glas und Stein, in dem ein paar Möbel treiben.“ Christian Bos
- Lutz Seiler:
Der Empfänger
Ein Spielball der Geschichte. Das atemberaubende Schicksal eines Deutsch-Amerikaners im Zweiten Weltkrieg.

Copyright: Klett-Cotta Verlag
San José, Costa Rica – Neuss – New York. Diese als Kapitelüberschriften eingesetzten Ortsangaben haben es in sich: Für den Leser in hiesigen Regionen verbindet sich mit ihnen auf Anhieb ein spektakuläres Auseinanderklaffen von Nähe und Ferne, Enge und Weite, Heimatlichkeit und Fremde. Wenn er dann noch die jeweiligen Zeitangaben zur Kenntnis nimmt – die Handlung spielt zwischen 1939 und 1953, also vor, in und nach dem Zweiten Weltkrieg –, dann ahnt er: Im Roman der in Mönchengladbach geborenen und in Berlin lebenden Autorin Ulla Lenze geht es, zeitgeschichtlich bedingt, rund.
Tatsächlich handelt „Der Empfänger“ von einer Lebensgeschichte, wie sie in ihren Widersprüchen und Verwerfungen nur vor dem Katastrophenhintergrund der Epoche möglich scheint. Die Hauptfigur heißt Josef Klein und trägt, wie wir erfahren, denselben Namen wie der Großonkel der Autorin. Dann ist er also der Großonkel – und das Ganze eine archivalisch erforschte Familiensaga? Nein, ist es nicht: Der reale Josef Klein wurde hier zur literarischen Figur – und als solche Träger von Bedeutsamkeiten jenseits biografischer Kontingenz.
Nach dem Ersten Weltkrieg wandert Klein aus dem heimatlichen Neuss nach New York aus, wo er sich schlecht und recht durchschlägt. Die Existenz des leidenschaftlichen Hobbyfunkers wird prekär, als sich in den 30er Jahren in der Community der deutschen Auswanderer massive Nazi-Sympathien breitmachen. Hitler wird als Mann der Stunde, als Vorbild auch für das „verjudete“ Amerika gefeiert. Hakenkreuze zieren die Einrichtung deutscher Lokale. Klein will sich aus all dem heraushalten, aber das gelingt ihm nicht: Dank seiner Funk-Fähigkeiten wird er interessant für einen deutschen Spionagering. Willenlos schlittert er in dessen Aktivitäten hinein, sendet mit Hilfe seines selbstgebauten Geräts geheime Nachrichten und Mitteilungen über den Äther in die fremd gewordene Heimat. In die Bredouille gerät er dann zumal durch seine amerikanische Freundin Lauren, die, entschieden anti-nazistisch gesinnt, ihm rät, sich dem FBI zu offenbaren.
Das alles sind – mehr oder weniger – Erinnerungsrückblenden aus dem Jahr 1949, das Josef Klein im zerstörten Neuss wiedersieht, wo er in der Familie seines Bruders strandet. Die hat NS-Zeit und Krieg an Ort und Stelle verbracht und beurteilt das Geschehene aus einer anderen Perspektive als der Rückkehrer – weshalb es auch rasch zu Spannungen kommt. Der zeitliche Zwischenraum – was ist von 1939 bis 1949 passiert? – füllt sich erst allmählich. Klein, ein Durchschnittstyp samt Ähnlichkeiten mit Heinz Rühmann, hatte, von der Situation überfordert, die Kooperation mit dem FBI abgelehnt und war daraufhin als Kriegsgefangener auf Ellis Island gelandet. Später stellte sich heraus: Seine Nazi-Auftraggeber waren zu jener Zeit Mitglieder der deutschen Abwehr gewesen, die deren Chef, der später hingerichtete Admiral Canaris, zu einem Zentrum des Widerstandes gegen Hitler ausgebaut hatte. An diesem Punkt verschwimmt die Grenze zwischen Gut und Böse endgültig.
Ulla Lenze gelingt es in ihrem Roman, all diese Zusammenhänge, anstatt sie einfach nur zu erörtern, in einem lapidaren, pointierten, in den Dialogen auch dramatisch zugespitzten, darüber hinaus atmosphärisch dichten sowie rhythmisch geschickt gliedernden Erzählen aufzulösen. Selbstredend aber ist es vor allem der atemberaubende Plot, die diese Geschichte lesenswert macht. Eine Alltagsexistenz zwischen den Mühlsteinen der Geschichte – wenn diese Story keinen historisch identifizierbaren Realkern hätte, müsste man auf jeden Fall sagen: Sie ist glänzend erfunden. Markus Schwering
- Ulla Lenze:
Dankbarkeiten
Da ist nur noch Stille. Delphine de Vigan hat ein leises, anrührendes Buch über das Alter geschrieben.

Copyright: DuMont Verlag
Zu Beginn sind es nur einzelne Wörter, die Michka vertauscht: Sie sagt Aufschub statt Aufzug, schwer statt her, Oje statt Okay. Aphasie, sagen die Ärzte. „Ich verliere gerade“, sagt Michka. Irgendwann kann die alte Dame nicht mehr allein in ihrer Wohnung leben und zieht in ein Seniorenheim. Alpträume, in denen eine strenge, unerbittliche Heimleiterin sie in einer Art Bewerbungsgespräch prüft, setzen ihr zu. Der Abschied von ihrer Wohnung, von ihrem alten Leben ist ein Abschied für immer: „Doch in Wirklichkeit, das weiß sie, hat sie die Anker gelichtet“. Die junge Marie, die früher ihre Nachbarin war, und die Michka aufzog, als deren Mutter mit der Betreuung überfordert war, kümmert sich liebevoll um sie. Und leidet darunter, dass sie nun mit der Frau, die einst stark und selbstständig war, die Doris Lessing, Virginia Woolf und Sylvia Plath las, sprechen muss wie mit einem Kind.
„Dankbarkeiten“ heißt der neue Roman der französischen Autorin Delphine de Vigan, die vor einigen Jahren mit „Nach einer wahren Geschichte“ wochenlang auf der Bestsellerliste ihres Heimatlandes stand. Einfühlsam und mit leisem Humor richtet sie nun ihren Blick auf das letzte Kapitel menschlichen Lebens. Viele Menschen verdrängen den Gedanken daran, dass auch sie eines Tages alt sein werden, Dinge verlernen, sterben. Und schauen sie auf diejenigen, die schon alt sind, dann sehen sie nichts anderes als deren Alter. Das weiß auch Jerome, der Logopäde, der mehrmals wöchentlich mit Michka trainiert und behutsam auf sie eingeht. Wenn er die alten Menschen zum ersten Mal sieht, sucht er deshalb nach „demselben Bild, dem des Vorher“. Er versucht zu erahnen, wie sie als junger Mann, als junge Frau aussahen: „Ich betrachte sie und denke: Auch sie, auch er hat geliebt, geschrien, Lust empfunden, getaucht, auf der Treppe immer mehrere Stufen auf einmal genommen, die Nacht durchgetanzt und und ist gerannt, bis ihr oder ihm die Luft wegblieb.“
Alle drei – Michka, Marie und Jerome – spüren, dass etwas zu Ende geht. Doch ein Umstand hält Michka noch davon ab, definitiv zu gehen. Während des Zweiten Weltkriegs lebte sie bei einem jungen Ehepaar. Ihre jüdische Mutter hatte die beiden angefleht, das Kind bei sich aufzunehmen, weil sie ahnte, dass sie es anders nicht würde schützen können. Michka sah ihre Mutter nicht wieder, sie wurde von den Nazis im KZ ermordet. Nach dem Krieg wuchs sie bei ihrer Tante auf, die ihr den Nachnamen des Ehepaars verschwieg. So kennt sie nur noch deren Vornamen. Und hat eine große Sehnsucht danach, sie wiederzufinden, weil sie sich bedanken will.
Dankbarkeit, das ist, wie schon der Titel verrät, das zweite große Thema dieses Romans. Denn auch wenn Michka alt und zerbrechlich ist, wenn sie auf Hilfe angewiesen ist, ihre Sprache verliert – Marie und Jerome können dennoch viel von ihr lernen. Am Ende des Lebens taktiert man nicht mehr, Michka weiß, dass es keine Schwäche ist, Zuneigung und Dankbarkeit zu zeigen, dass nur starke Menschen ihre eigene Verletzlichkeit nicht verbergen. Und so kann auch Marie noch rechtzeitig „danke“ sagen: „Danke für alles. Ohne dich wäre ich nicht das, was ich geworden bin.“
Delphine de Vigan hat ein leises, anrührendes Buch geschrieben, das unaufgeregt der Frage nachgeht, was wirklich wichtig ist im Leben. Am Ende ist man traurig, Abschied nehmen zu müssen – von diesem Buch und von Michka, die eine so faszinierende Persönlichkeit ist, dass man sich wünscht, noch viel mehr von ihr erfahren zu haben. Anne Burgmer
- Delphine de Vigan:
Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst
Pointensicher aneinander vorbei reden. Ein Durchschnittsbuch über eine Durchschnittsehe von Nick Hornby.

Copyright: Kiepenheuer&Witsch Verlag
Die größte Überraschung für alle Leser, die das Gesamtwerk von Nick Hornby verfolgt haben, dürfte der sperrige Titel seines neuen Buches sein. Mit „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“ brechen der englische Beststeller-Autor und sein Kölner Verlag Kiepenheuer & Witsch mit einer Tradition: Von „High Fidelity“ bis „Miss Blackpool“ hatten Hornbys Romane, sieben an der Zahl, auch in der deutschen Fassung ihren britischen Originaltitel behalten.Aber gut, „State of the Union“, wie das Werk ursprünglich heißt, ist auch kein Roman, sondern, so das Kleingedruckte auf dem Cover, eine „Ehe in zehn Sitzungen“. Hornby hat seine Gabe für das filmische Schreiben in den vergangenen Jahren verfeinert, was 2015 in eine Oscar-Nominierung für den Film „Brooklyn“ gipfelte. Für das Drehbuch adaptierte er einen Roman des Iren Colm Toibin.
„Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“ liest sich wie ein Theaterskript, das zu gefühlt 95 Prozent aus Dialogen besteht, der Rest sind Regieanweisungen à la „Louise lacht leise“ oder „Tom verdreht die Augen“. Dazu hat er auch allen Grund: Tom hat eingewilligt, sich mit seiner Gattin einer Paartherapie zu unterziehen, auch wenn er diese komplett sinnfrei findet. Alle zehn Kapitel starten mit einer Begegnung im Pub gegenüber der Therapeutinnen-Praxis, Louise trinkt sich mit trockenem Weißwein Mut an, er mit (mindestens) einem Pint London Pride.
Louise und Tom ist eine Londoner Mittelmaß-Ehe: Zwei Kinder; sie 40, er vier Jahre älter; sie ist Ärztin beim NHS, er Musikkritiker, allerdings arbeitslos. Hornby-Kenner werden bei diesem Detail gleich an Rob Fleming denken, den Schallplattenladenbesitzer und Top-5-Listen-Verfasser aus „High Fidelity“. Dazu passt, dass Stephen Frears, der „High Fidelity“ verfilmte und den Plattenladen „Vinyl Championship“ dafür von Islington nach Chicago verlegte, für „State of the Union“ wieder ins Team Hornby eingestiegen ist. Als Drehbuch/Regie/Produzenten-Gespann realisierten sie „State of the Union“ als Mini-Serie im britischen Fernsehen (Ausstrahlung im Mai 2019) mit Rosamund Pike und Chris O’Dowd in den Hauptrollen.
Dass eine fiktive Paartherapie ein Mordsspaß sein kann, wenn sich handwerklich gute Komödianten wechselseitig Gemeinheiten an den Kopf werfen, hat zuletzt „Merz gegen Merz“ mit Christoph Maria Herbst und Annette Frier gezeigt. Hornbys Szenario funktioniert allerdings anders: Die eigentlichen Therapierunden hat er ausgespart, alle Szenen spielen vorher und nachher im Pub oder auf der Straße davor. So beobachten Tom und Louise durch das Kneipenfenster, wer aus der Praxis kommt und ergehen sich in Spekulationen, wie diese Leute wohl drauf sind.
Nicht nur ihre Ehe ist an Höhepunkten arm: Tom und Louise bleiben im Buch derart konturlos und durchschnittlich, dass ihre Streitgespräche nur sporadisch Funken schlagen. Am besten funktioniert das verbale Pingpongspiel, wenn die beiden pointensicher aneinander vorbeireden. Sie: „Ich will nicht davor wegrennen.“ Er: „Natürlich nicht. Egal, wie schlimm es auch laufen mag, es ist ja nur eine Stunde.“ Sie: „Ich meinte die Ehe, nicht die Beratung.“ Lustig und giftig geht es auch zu, wenn das Paar sich über den Brexit in Rage redet oder darüber sinniert, ob ihre kriselnde Ehe, medizinisch gesprochen, eher mit Krebs oder Ebola zu vergleichen ist. Die TV-Serie „State of the Union“ dauert übrigens nur zehn mal zehn Minuten. Auch die Lektüre ist kaum abendfüllend. Thorsten Keller
- Nick Horny:
Die drei Dimensionen der Freiheit. Ein politischer Weckruf
Neues England, alte Welt. Billy Braggs Forderung nach verantwortlicher Freiheit.

Copyright: Heyne Verlag
Er wolle die Welt gar nicht ändern, bekannte Billy Bragg in seinem berühmtesten Lied. Er schaue sich nicht nach einem neuen England um, nur nach einem neuen Mädchen. Das war schon damals, 1983, im fünften Jahr der Regierung Thatcher, tief gestapelt. Aber Bragg, der Barde aus Barking, stieg eben deshalb zum wichtigsten politischen Liedermacher des Vereinigten Königreichs auf, weil er die Verhältnisse nicht aus Überflughöhe kritisierte, sondern aus der Perspektive des „ordinary bloke“, des stinknormalen Typen von nebenan. In seinem 2017er Song „Full English Brexit“ versetzt sich der „linke Patriot“ gar in die Lage eines bigotten Brexiteers, der am Tresen seines Pubs über den verlorenen Ruhm des Empires klagt.
Wer sonst als Bragg sollte also eine neue Reihe mit politischen Interventionen britischer Musiker für den Verlag Faber & Faber einleiten, eine lose Folge kurzer Pamphlete im Sinn des Gründervaters Thomas Paine („Die Rechte des Menschen“)? „Die drei Dimensionen der Freiheit“ hat Bragg seinen „politischen Weckruf“ genannt, der jetzt auf Deutsch erschienen ist. Darin zieht er unter den Überschriften „Liberalität“, „Gleichheit“ und „Verantwortung“ die Summe der vergangenen 40 Jahre, also der Zeit, in welcher der Neoliberalismus als wirtschaftspolitische Ideologie die sozialdemokratisch geprägten Nachkriegsjahre abgelöst hat – und zufällig auch die Ära, in der Bragg als Sänger und Songschreiber aktiv war.
„Nie zuvor hatten wir Menschen so viel Macht wie heute“, hebt Bragg an. Und nie zuvor, ergänzt man still im Kopf, fühlten wir uns zugleich so machtlos. Was daran liegt, so der Autor, dass neben der Möglichkeit unendlicher Vernetzung, „die Möglichkeiten des Einzelnen, die eigene wirtschaftliche Situation selbst zu gestalten, in den vergangenen Jahrzehnten verringert worden“ ist. Und es sei ebendieser Mangel an Handlungsfähigkeit, der, so Bragg, zu der Welle an populistischer Wut geführt habe, die sich schon seit geraumer Zeit in den westlichen Demokratien ausbreitet. Im Folgenden zeigt er, wie die radikal-liberale Wirtschaftstheorie des Ökonomen Friedrich von Hayek diejenige von John Maynard Keynes abgelöst hat, in welcher der Staat regulierend in den freien Markt eingreifen soll. Selbstredend beklagt er den Verlust an Verantwortlichkeit – der dritten Dimension der Freiheit – der damit einhergeht.
Im Kapitel „Gleichheit“ zeigt Bragg, wie die alten Eliten versuchen, ihren gesellschaftlichen Status zu zementieren: „Exklusivität war der Schlüssel zu ihrer Macht und musste daher gegen die inklusiven Intentionen von Außenseitern verteidigt werden.“ Diese Exklusivität sichern sich Konservative bis heute mit Hilfe von Kampfbegriffen wie „politische Korrektheit“ oder „kultureller Marxismus“, durch die sie sich als von Gutmenschen bedrohte Minderheit umdefinieren. Und erneut plädiert Bragg für Verantwortlichkeit: „Zu Hause in deiner Komfortzone hast du die Freiheit, zu tun und zu sagen, was du willst. In der Öffentlichkeit jedoch gelten andere Regeln.“ Und weiter geht es mit MeToo und dem Cambridge-Analytica-Skandal, mit Trumps Twitter-Politik und natürlich auch dem Brexit. Das klingt nun eher nach Suada, als nach Pamphlet, doch dem Autor gelingt es, alle Unbill dieser Zeit unter seiner Forderung nach verantwortlicher Freiheit zu ordnen. Es steht nichts Neues in Braggs Brevier, aber es ist von bewundernswerter Klarheit. Letztlich ist „Die drei Dimensionen der Freiheit“ ein Aufruf, wieder mehr Sozialdemokratie zu wagen. Braggs will kein neues England, er will die alte Welt zurück. Christian Bos
- Billy Bragg:
Die Detektive vom Bhoot-Basar
Jai und die Detektive. Drei indische Kinder ermitteln in einem brisanten Kriminalfall.

Copyright: Rowohlt Verlag
Die Lage ist ernst. Im Slum einer nordindischen Großstadt verschwindet ein Kind nach dem anderen. Spurlos. Doch die Polizei mischt sich nicht ein. Da scheint Jai der einzige zu sein, der den Fall aufklären könnte. Zumindest sieht es der neunjährige Junge so. Immerhin hat er hunderte Folgen der TV-Reihen „Police Patrol“ und „Live Crime“ studiert. Daher weiß er, wie man einen Täter überführt.
Deepa Anapparas Roman „Die Detektive vom Bhoot-Basar“ kommt zunächst daher wie eine indische Variante von „Emil und die Detektive“ für Erwachsene. Allerdings stellt sich bald heraus, dass sich die Autorin und ehemalige Journalistin einer scheußlichen Aktualität widmet. Tatsächlich ist die Zahl der Kinder, die auf dem Subkontinent entführt werden, enorm; und die männlichen Übergriffe auf junge Frauen, die auch in den europäischen Nachrichten erwähnt werden, kommen ebenso zur Sprache. Diese Mischung aus funkelnder Phantasie und krimineller Realität gelingt der Autorin auf begeisternde Weise.
Anappara hat ihr Roman-Debüt auf drei Ebenen errichtet. Auf der einen sind wir jeweils kurz mit den Entführungsopfern unterwegs, unmittelbar bevor eine Hand nach ihnen greift, ein Licht sie blendet, ein chloroformierter Schal über sie fällt. Auf einer zweiten Ebene werden Geschichten erzählt, die angeblich das Leben retten können. In einer Welt, in der die Armut kraftlos macht und die Polizei korrupt ist, bleibt zuweilen nichts als Aberglaube. So können sich Straßenkinder in höchster Not an den ehemaligen Bandenführer Mantel wenden. Und Frauen, die von Männern belästigt werden, sollten die so genannte Straßen-ki-Rani anrufen, die ihre Tochter durch vier Vergewaltiger verloren hatte: „Im Gesicht jedes Mannes sah sie das Gesicht des Mörders ihrer Tochter.“ Schließlich beteuern die Tempel-Geister: „Egal, was euch bedrückt, vertraue uns: Die Dschinns werden es vertreiben.“
Vor allem aber sind wir mit dem naiv-gewitzten, rundum sympathischen Jai unterwegs. Als er den Fall übernimmt, der den Verlagsangaben zufolge auf einem wahren Verbrechen basiert, weiht er seine besten Freunde ein. Blöd nur, dass der Muslim-Junge Faiz und das Hindu-Mädchen Pari nicht einsehen wollen, dass er der Chef ist. So laufen die beiden los, bevor er das Kommando gibt, oder sie stellen Fragen, auf die er selbst nicht gekommen ist. Jai merkt: Detektiv zu sein ist nicht so einfach.Der Leser steht bald schon mittendrin in diesem kochenden Getümmel. Die Schilderungen der Alltagsdetails wecken dabei Erinnerungen an Salman Rushdies „Mitternachtskinder“, dem Indien-Roman aller neuzeitlichen Indien-Romane. Aber auch Szenen aus Danny Boyles Mehrfach-Oscar-Film „Slumdog Millionär“ und dem ihm zugrundliegenden Roman „Rupien! Rupien!“ von Vikas Swarup klingen an. Die vielen Original-Vokabeln werden in einem Glossar erklärt, was der Story eine schöne Würze gibt: Von „Basti“ für ein Armenviertel bis zu „Bhoot“ für einen Geist.
Rund um den Bhoot-Basar spielt das individuelle Drama von Armut und Würde, hier gärt der nationalistische Konflikt zwischen Hindus und Moslems, hier errichten Gangs und Polizisten eine Ordnung eigenen Rechts, hier vibriert die soziale Unwucht zwischen den Slum-Bewohnern und den Reichen in den nahen Hochhäusern. Dass daraus keine niederdrückende Erzählung geworden ist, sondern eine faszinierende und mit vielen komischen Szenen durchsetzte Kriminalgeschichte, liegt an dem Blickwinkel des Neunjährigen, für den sich Deepa Anappara entschieden hat. Jai macht das Schwere leichter lesbar. Martin Oehlen
- Deepa Anappara:
Der Sinn des Ganzen
Gefühle hinter Panzerglas. Anne Tylers Protagonist mag sein Leben langweilig – aber das Drama holt ihn ein.
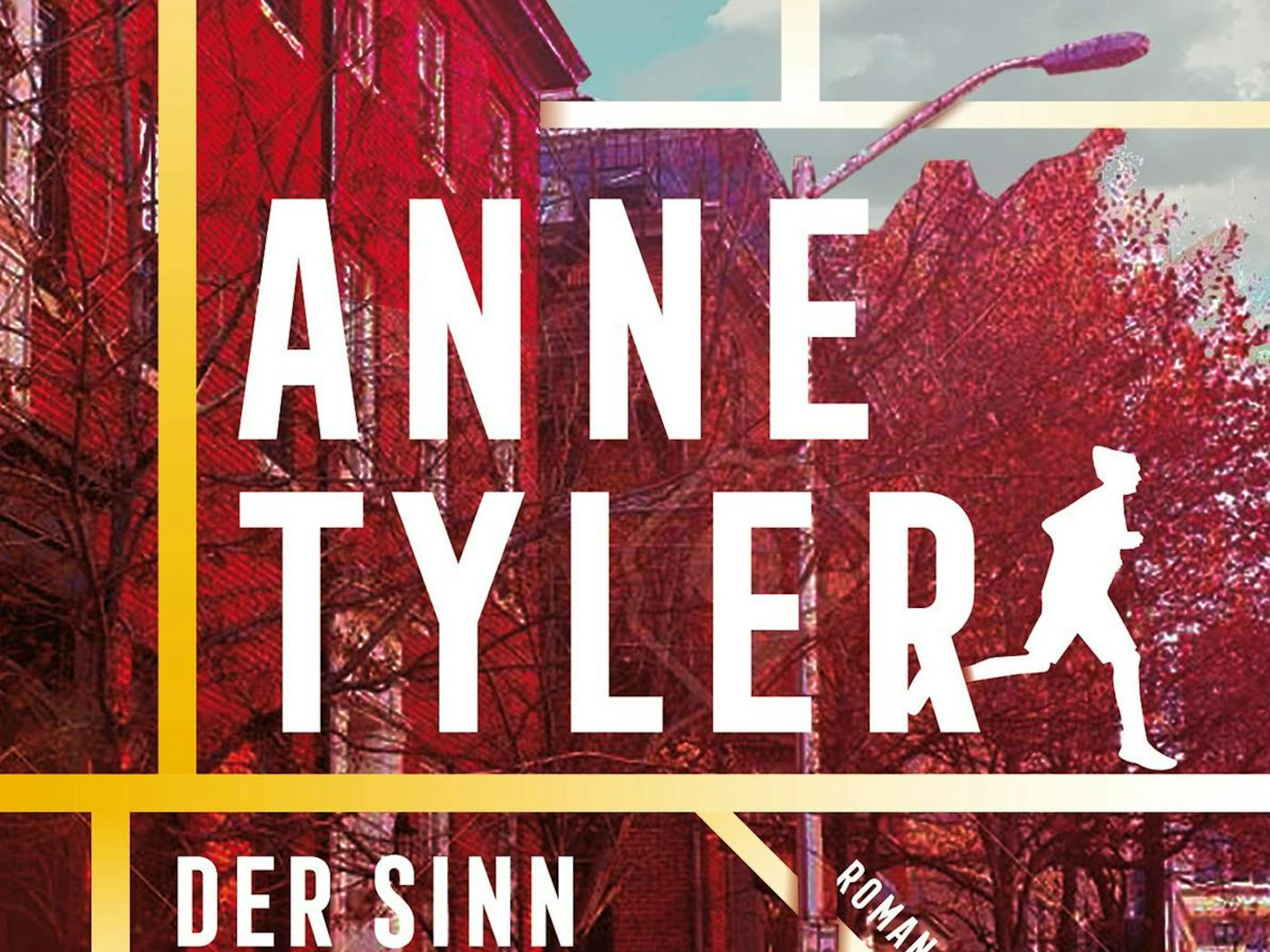
Copyright: Kein&Aber Verlag
In einem ihrer sehr seltenen Interviews erzählt Anne Tyler der britischen Zeitung „Guardian“, dass sie ihre Geschichten gerne durch die Augen eines männlichen Ich-Erzählers sieht. Weil sie Männer mag und in einem männlich-dominierten Haushalt aufgewachsen ist. Beim Schreiben merke sie allerdings immer wieder, dass es ihnen in unserer Gesellschaft nicht erlaubt sei, Gefühle offen zu zeigen – und noch viel weniger, über sie zu sprechen. „Es fühlt sich an, als würde man einen sehr schmalen Weg zwischen hohen Mauern entlanggehen“, sagt die amerikanische Pulitzerpreisträgerin („Atemübungen“). Ein Gefühl, dass Micah Mortimer, ihre Hauptfigur in „Der Sinn des Ganzen“, kennen dürfte. Seine Mauern sind wohl aus Panzerglas, er sieht hindurch, beobachtet seine Mitmenschen, ruft ihnen etwas zu, interessiert sich aber nur bis zu einem gewissen Grad für ihr Leben.
Er bleibt lieber hinter der schlagsicheren Scheibe seiner Alltagsrituale. Bitte keine Aufregung. Jeden Tag beginnt Micah mit einer Joggingrunde durch seine Heimatstadt Baltimore, wo nahezu jeder von Tylers mehr als 20 Romanen spielt. Anschließend duscht und frühstückt er, widmet sich dann geduldig den Computerproblemen seiner Kunden aus der Nachbarschaft. Als „Tech-Eremit“ fährt er durch die Stadt, stets darauf bedacht, sich penibel an die Verkehrsregeln zu halten und rettet Menschen den Tag, deren Glück von einem funktionierenden Drucker, einer Amazon-Bestellung oder der gelöschten Porno-Sammlung des Nachwuchses abhängt. Micah hingegen scheint allein die Unkompliziertheit seines Daseins zu erfreuen, seine Freundin Cass findet er „in Ordnung“, seine lebhafte Familie in kleiner Dosierung „faszinierend“. Er erträgt stoisch ihren Spott über seine Pingeligkeit und seine festen Staubsauger- und Wäsche-Waschtage. Sein kleiner Kosmos gerät erst in Schieflage als Brink vor seiner Tür steht. Er ist der Teenagersohn seiner College-Ex-Freundin Lorna und überzeugt, dass Micah sein Vater ist. Er selbst würde nicht in seine zielstrebige, karriereorientierte Familie passen, „Ich bin viel eher wie Sie“. Brink quartiert sich auch gleich über Nacht im Arbeitszimmer ein, weckt Cass’ Argwohn und bringt Micah genau das in seine Souterrainwohnung, was er nie dort haben wollte: die Unordnung des menschlichen Dramas.
Klaubt man die spärlichen Informationen über Anne Tyler zusammen, drängt sich der Eindruck auf, dass sie und Micah einiges gemeinsam haben. Auch sie lebt eher zurückgezogen, schreibt jeden Roman nach festen Ritualen (in einer Karteikarte sammelt sie Gesprächsfetzen und Ideen, braucht bei jedem Buch genau einen Monat, um ihre Protagonisten aus diesen zu entwickeln), legt nicht viel Wert auf Rezensionen, geht nie auf Lesereise. Ihre Bücher handeln meist von amerikanischen Mittelklasse-Familien, die sich durch komplizierte Beziehungsgeflechte mit Kommunikationsschwierigkeiten auszeichnen.
Dabei droht sie öfter, die Belanglosigkeit zu streifen. Menschen mit normalen Problemen, die nicht darüber reden – nicht unbedingt der Stoff, aus dem die ganz großen Geschichten sind. Doch die Autorin verdichtet die Handlung in „Der Sinn des Ganzen“ auf kleinformatigen 220 Seiten so sehr, dass der Roman nicht langweilig ist – und an einem verregneten Nachmittag durchgelesen werden kann. Am Ende der Lektüre bleibt offen: Was ist für Micah der Sinn des Ganzen? Möglichst unverletzt, ohne Geschwindigkeitsüberschreitungen und mit gesaugtem Boden durchs Leben zu gehen – oder das Drama inklusive knallender Türen und schmutziger College-Blazer hereinzulassen? Nadja Lissok
- Anne Tyler:
Der Krieg der Armen
Die Geschichte ist nie abgeschlossen. Éric Vuillard erzählt einen historischen Konflikt aus neuer Perspektive.
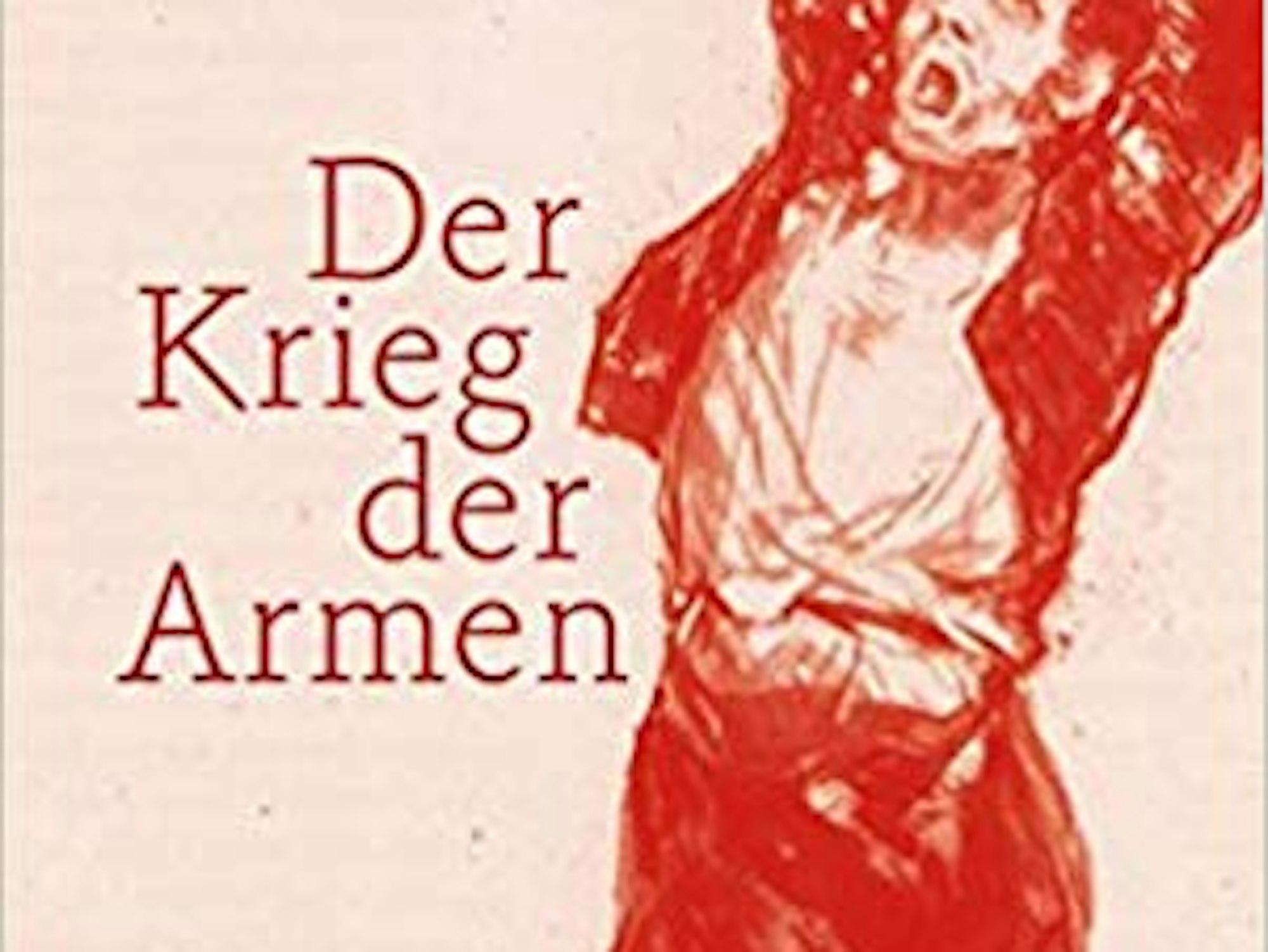
Copyright: Matthes&Seitz Verlag
„Aber es war nicht Gott. Es waren die Bauern, die sich erhoben. Es sei denn, man nennt den Hunger, die Krankheit, die Demütigung und die Lumpen Gott.“ In seinem neuen Buch „Der Krieg der Armen“ schaut der französische Autor Eric Vuillard auf einen historischen Konflikt: den Aufstand der Rechtlosen und Unterdrückten gegen die Herrschenden. Er schildert diesen Konflikt an zwei Epochen: Das sind die Bauernaufstände im 14. Jahrhundert in England und die deutschen Bauernkriege von 1525/26. In den Fokus seiner Erzählung stellt Vuillard den deutschen Theologen Thomas Müntzer. Er ist ein Reformator wie Martin Luther. Aber im Gegensatz zu ihm radikalisiert er sich und wird zu einem Anführer in den Bauernkriegen.
Wie auch in seinen vorhergehenden Büchern „Die Tagesordnung“ und „14. Juli“ bewegt sich Vuillard an der Schnittstelle von Geschichte und Literatur. Er greift einen Moment in der Historie heraus, schlüpft in ihn hinein, lässt Personen und Situationen auf seiner Bühne lebendig werden. All das hoch verdichtet in einer elegant brillierenden Kunstsprache. Mit Müntzer hat er einen wortgewaltigen Protagonisten gefunden, der allein durch seine flammenden Predigten und Reden gewirkt hat. Müntzer ist der erste Pfarrer, der sich in deutscher Sprache an seine Gemeinde wendet. Er will, dass die Menschen die Bibel endlich verstehen können. Dass sie das Wort Gottes unverstellt und nicht vermittelt durch die Riten des Klerus vernehmen.
Als die Obrigkeit daraufhin den Besuch seiner Gottesdienste verbietet, empört und radikalisiert sich Müntzer: „Wie gewalttätig er plötzlich ist, wie es in ihm hochkocht!“ Müntzer spricht von einer Welt ohne Privilegien, in der „Fürsten und Diener, reich oder arm, aus dem gleichen Gassenschlamm geknetet“ seien. Er wird zu einem Wortführer der Unzufriedenen. Im Mai 1525 zieht er in die Schlacht von Frankenhausen. Der zusammengewürfelte Haufen aus Bauern, Handwerkern und Landstreichern hat keine Chance. Die Reiterarmee der Fürsten schlägt den Aufstand blutig nieder. Müntzer wird gefangen genommen und enthauptet.
Vuillard erzählt keine Heldengeschichte. Er zeigt Müntzer als einen messianischen, manchmal sektiererischen und aggressiven Menschen. Was hat ihn an Müntzer interessiert? Zum einen zeigt sich in dessen Person der Wandel, den der Buchdruck einleitet. Wissen und Religion werden zugänglich und interpretierbar. Zum anderen ist es die Art und Weise, wie Müntzer seine theologische Rede nutzt, um das bestehende System in Frage zu stellen:„In Wirklichkeit betrifft der Zwist um das Jenseits die Dinge dieser Welt. Darin liegt die ganze Wirkung, die jene aggressiven Theologien noch immer auf uns haben.“
Vuillards häufig geäußertes Credo lautet: Die Geschichte ist nicht abgeschlossen. Wir sind ein Teil von ihr und erzählen sie immer wieder neu von unserem aktuellen Standpunkt aus. Diese Haltung spiegelt sich auch in der Subjektivität seiner Texte. Dass einige Quellen den verurteilten Müntzer als einen reuigen Mann zeigen, quittiert er mit den Worten: „Ich glaube kein Wort davon.“ Die sehr konkrete Aktualität, die unweigerlich bei „Der Krieg der Armen“ mitschwingt, sind die Proteste der Gelbwesten in Frankreich. Es gibt zum Glück keine platten Analogien. Aber Vuillard ordnet die modernen Proteste gegen eine als ungerecht und hermetisch empfundene Obrigkeit in eine Genealogie ein. Dabei erhellt, so der Autor, nicht die Vergangenheit die Gegenwart, sondern umgekehrt: Die Gelbwesten erneuern unseren Blick auf die Aufständischen des 16. Jahrhunderts. Elke Biesel
- Eric Vuillard:
Die Hosen der Toten
Das Ende der „Trainspotting“-Saga. Ein letztes Mal widmet Irvine Welsh seiner schottischen Gang einen Roman.

Copyright: Heyne Verlag
Es klingt nach leicht verdientem Geld, auch wenn der Auftrag nicht ganz koscher ist: Daniel „Spud“ Murphy, der herzensgute Blödmann in Irivine Welshs „Trainspotting“-Ensemble, soll eine Spenderniere im Zug von Istanbul nach Berlin schmuggeln. Dummerweise nimmt er seinen Hund Toto mit auf diese Mission. Als Spud kurz aus dem Abteil zum Speisewagen geht, wirft das ebenfalls hungrige Tier die Spezial-Kühltasche um. Und entdeckt, dass Niere doch besser schmeckt als Frolic…
Seit dem ersten „Trainspotting“-Buch, das in Deutschland im Sommer 1996 etwa zeitgleich mit Danny Boyles Romanverfilmung herauskam, gilt der Schotte Irivine Welsh als Spezialist dafür, selbst ausgesprochen eklige Szenen vergnüglich zu erzählen. Der herbe Nach-mir-die-Sintflut-Charme seiner Heroin-Helden eroberte die literarische Welt und verankerte Leith, einen damals extrem abgerockten (und inzwischen gründlich gentrifizieren) Stadtteil von Edinburgh, auf der Subkultur-Weltkarte. Der herbe Nach-mir-die-Sintflut-Charme seiner Heroin-Helden eroberte die literarische Welt und verankerte Leith, einen damals extrem abgerockten (und inzwischen gründlich gentrifizieren) Stadtteil von Edinburgh, auf der Subkultur-Weltkarte.
Die Geschichte der Gang, deren harter Kern aus drei Junkies (außer Spud noch Mark Renton und Sick Boy) und einem leicht reizbaren, erbarmungslosen Schläger besteht (Frank Begbie, der allerdings „Nein“ zu harten Drogen sagt), ist für Welsh zu einem Lebenswerk angewachsen. Erst schrieb er ein Sequel („Porno“), dann einen ziegelsteindicken Roman mit der Vorgeschichte. „Skagboys“ (2013) machte begreiflich, warum seine Helden später dieses Leben zwischen Spritze und Stütze fristen werden. Er sehe Margaret Thatcher als „eine Art Ghostwriterin“ für diesen Roman, erklärte Welsh damals in einem KStA-Interview. Ihre neoliberale Politik habe die Arbeiterklasse zerstört und jenes Elend ausgelöst, das viele junge Briten in den 1980er-Jahre an die Nadel brachte.
Mit „Die Hosen der Toten“ bringt Welsh seine „Trainspotting“-Saga nun zu einem Ende – nach mehr als 2100 Seiten. Dass es kein fünftes Buch geben wird, hat der Autor jedenfalls in einem „Independent“-Interview versprochen und das so begründet: Weil einer der vier Protagonisten in diesem Roman ins Gras beiße, sei die Gang als Ganzes für ihn gestorben. Wer das ist, darf natürlich nicht verraten werden. Die Szene mit dem verhinderten Organschmuggel ist der Brandbeschleuniger, der die Handlung in Schwung und die Protagonisten in größte Schwierigkeiten bringt. Der rasante Plot geht buchstäblich an die Nieren. Die Geschichte spielt in den Jahren 2015 und 2016, und so hat Welsh, bekennender Fan des FC Hibernians, noch eine irre Volte der schottischen Sportgeschichte an zentraler Stelle eingebaut: Den Pokalsieg seiner „Hibs“ gegen die großen Glasgow Rangers – für die in die Jahre gekommenen Freunde wird es der schönste Tag ihres Lebens.
Das echte Cupfinale 2016 war eine klassische Against-All-Odds-Geschichte, den Hibs haftete bis dahin ein Loser-Image à la Leverkusen an. Wider jede Wahrscheinlichkeit ist im Roman auch die Verwandlung von Begbie, der dem Alkohol und dem Koks abgeschworen hat (der Gewalt nicht ganz), und vom Knastbruder zum angesehen bildenden Künstler mutiert ist. Ein Handlungsstrang führt daher auch nach Los Angeles, wo Jim Francis, so sein Künstlername, inzwischen mit Frau und Kindern lebt. Und doch nicht angekommen ist. Auch unter kalifornischer Sonne holt ihre proletarische Herkunft Begbie und Mark Renton ein. Der einmal auf Zlatan Ibrahimovic gemünzte Spruch, wonach du das Kind aus dem Ghetto holen kannst, aber das Ghetto nicht aus dem Kind, gilt auch in Irvine Welshs Welt. Thorsten Keller
- Irvine Welsh:
Allegro Pastell
Liebesglück und Sinnsuche. Leif Randt hat eine Beziehungs-Geschichte der Gegenwart geschrieben.
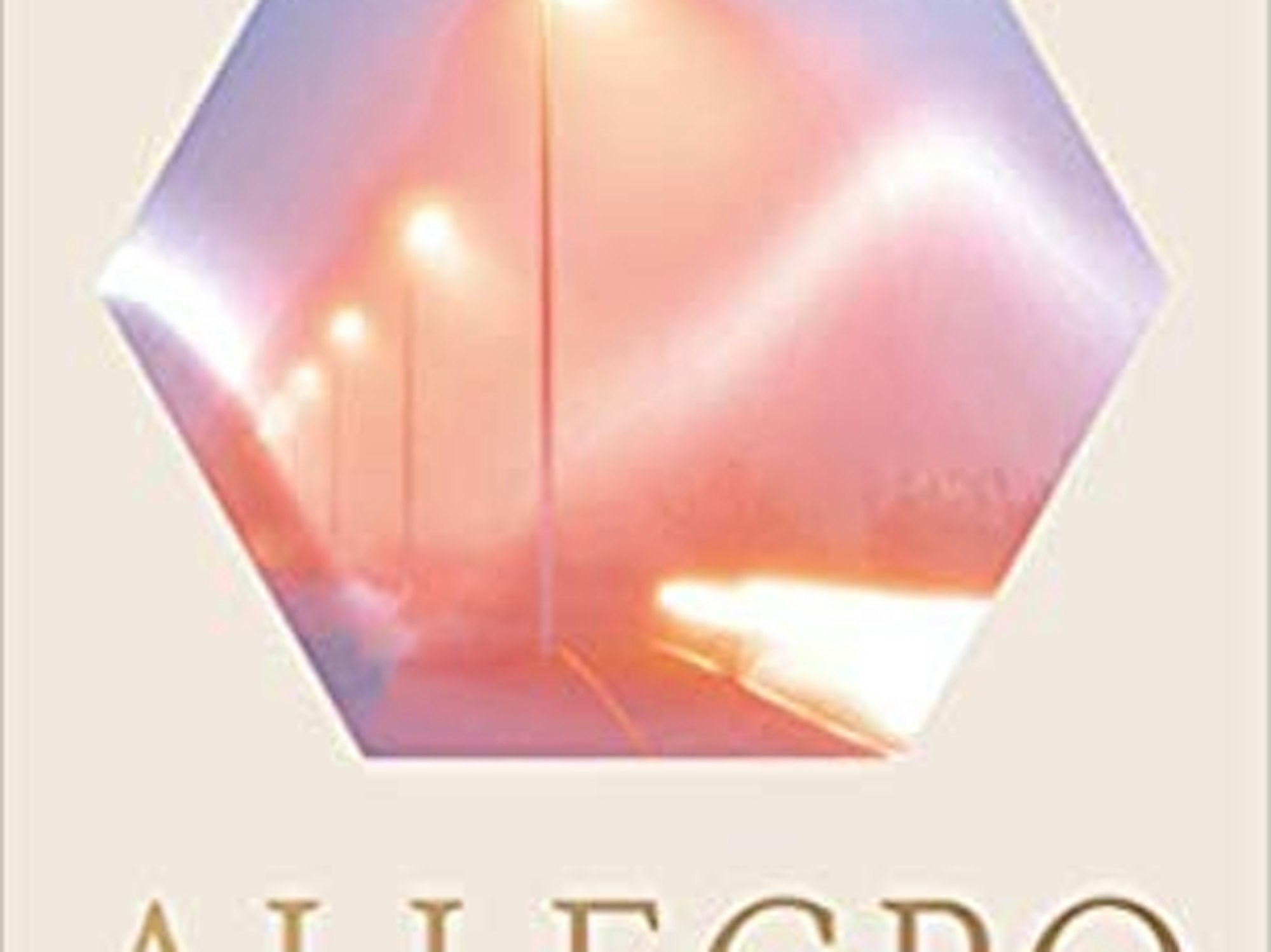
Copyright: Kiepenheuer&Witsch Verlag
Das Glück ist wahrscheinlich ein Kreisel. Kaum lässt man ihn aus der Hand, taumelt er flirrend und wunderschön über die Oberfläche. Tanzt mal hierhin, mal dahin, seine Farben zerfließen ineinander und wer zuschaut, den versetzt seine Anmut in einen Rausch des „Das darf niemals enden“-Gedankens. Und doch ist die Versuchung des Festhaltenwollens zu groß. Und dann gerät da eine fleischige, linkische Hand ins Blickfeld und packt, was nur im unkontrollierten Flirren seinen Reiz hatte – und hält plötzlich bloß noch einen hölzernen Klotz zwischen den Fingern.
Die Liebe von Tanja und Jerome in Leif Randts Roman „Allegro Pastell“ hat die Anlage zur Perfektion. Sie, knapp dreißig, wohnhaft nahe des Berliner Volksparks Hasenheide, ist eine erfolgreiche Autorin. Er, fünf Jahre älter, gefragter Webdesigner und auf dem Weg zur spirituellen Einkehr, residiert im Maintal im Bungalow seiner Eltern. Eine Fernbeziehung, die eigentlich gar nicht so genannt werden kann, denn mal abgesehen von den physisch trennenden Kilometern, ist die Nähe des Paares vorbildlich. Sie bleiben über Chats sogar beim Treuebruch so eng verbunden, wie es den meisten Paaren nicht einmal gelingt, wenn sie jeden Abend nach den Spätnachrichten im Reihenendhaus nebeneinander einschlafen. An den gemeinsamen Wochenenden verweben die beiden durch großzügige Nadelstiche ihre beiden entfernten Welten zu einem ganz eigenen Beziehungskleidungsstück, das zwar hier dem einen ein bisschen zu spirituell, dort dem anderen ein wenig zu pragmatisch-sportlich daherkommt, am Ende aber doch beiden ganz zauberhaft zu Gesicht steht.
„Allegro Pastell“ könnte fast ein perfekt langweiliger Liebesroman sein. Ein bisschen Sex, ein bisschen Generation-Facebook, ein bisschen Freelance-Arbeitsleben, ein bisschen Rausch, ein bisschen Pflichterfüllung, ein bisschen CDU. Wäre da nicht der Versuch der beiden so Glücklichen, den flirrenden Kreisel zu packen und festzuhalten, ihr Liebesglück zu konservieren. Es ist das erste Mal, dass sich der 37 Jahre alte Autor für seinen Roman keine Future-Welt ausdenkt. Von den Parallelwelten eines „Coby County“ oder „Planet Magnon“ landet er in der südhessischen Bungalow-Realität und man könnte meinen, das würde beim Aufsetzen ziemlich ruckeln, aber das ist gar nicht der Fall. Leif Randt schreibt diese Geschichte der Gegenwartsrealität so geschmeidig, als würde sie sich direkt an unseren Alltag anschmiegen. Wohlig wird es da manchmal, aber auf jeden Fall positiv.
Und doch dämmert zwischendurch dem geneigten Leser und der geneigten Leserin, dass dieses wohltemperierte Liebesglück auf etwas furchtbar Sinnentleertem fußen könnte. Und irgendwann im Laufe der Lektüre taucht schwarz und wie ein depressiver Waver-Gast auf einer Schlagerparty die Frage auf, was das eigentlich alles soll. Knisternde Anfänge, höfliche Fortgänge, langweilige Minuskurven, die kurzfristige Affären wieder ins Plus katapultieren sollen. Kann all dieses relativ glückliche Rumkreiseln und Festhaltenwollen ein Leben ausmachen? Ihm Tiefe und Erfüllung geben? Oder dienen die Liebe und die Mühe des sich gegenseitig Nahekommens, sich Wegstoßen, um sich wieder nahe zu kommen, am Ende nur dem Zweck einer Beschäftigungstherapie? Was soll man sonst auch tun, 24 Stunden lang, 365 Tagen im Jahr, jedes Jahr aufs Neue. Man kann ja auch nicht durchgehend zugekokst ins Future-Fantasy-Land fliehen. Claudia Lehnen
- Leif Randt:
Die rechtschaffenen Mörder
Der Zurückgelassene. Wie ein belesener Mensch zum rechten Täter werden konnte.

Copyright: S.Fischer Verlag
Norbert Paulini ist ein rechtschaffener Mann, der sein Leben dem Lesen verschrieben hat. Er führt in Dresden-Blasewitz seit 1977 ein Antiquariat und zieht Bücherliebhaber und Literaten aus aller Welt an. So auch Herrn Schultze, den Erzähler dieser Geschichte. Dieser begleitet Paulinis Lebensweg 40 Jahre lang durch alle Höhen und Tiefen. Vom Mauerfall, der Insolvenz seines Geschäfts, der Konkurrenz durch das Internet, bis hin zur gescheiterten Ehe. Trotz der revolutionären Zeiten bleibt Paulini seiner unpolitischen Linie und seinen Büchern eisern treu.
Die Dreiteilung des Buches ist vor allem erzählerisch begründet. Während der erste Teil Paulinis Werdegang nacherzählt, gibt der zweite Teil Einblicke in die Sichtweise des Ich-Erzählers. Schultze trat bereits sehr früh dem Lesezirkel des Antiquars bei. Als er eine Affäre mit dessen Angestellten Lisa beginnt, gerät er unwissentlich in eine Dreiecksbeziehung. Von Eifersucht zerfressen, fängt er an, einen Roman über Paulini zu schreiben – sozusagen ein Buch im Buch.
Es wundert nicht, dass auch in dieser Geschichte ein Erzähler auftaucht, der von Beruf Autor ist – das war auch schon bei Ingo Schulzes letztem Erzählband „Handy. Dreizehn Geschichten in alter Manier“ so. Diese Selbstreflexivität wird zum Leitmotiv des Romans „Die rechtschaffenen Mörder“, der für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert ist. Doch wer die Auflösung zum Schluss erwartet, wird enttäuscht: Der plötzliche Tod von Paulini und Lisa bleibt unaufgeklärt. Denn um die Aufklärung geht es gar nicht. Der Erzähler spielt geschickt mit dem, was wir als Wahrheit oder Lüge empfinden. Er baut ein Bild des großen stoischen Literaten Norbert Paulini auf, nur um es dann wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen zu lassen. Zum Ende des zweiten Teils steht plötzlich ein aufbrausender Mensch vor uns, der an fremdenfeindlichen Übergriffen beteiligt zu sein scheint. Nur im dritten Teil wechselt die Erzählinstanz zu seiner Lektorin.
Den Autor Ingo Schulze und den fiktiven Erzähler Schultze im Buch trennt wohl nicht ohne Grund nur ein ergänztes „t“ voneinander. Dies und die bildliche Gestaltung des Covers als Buch auf dem Buch tragen weiter dazu bei, die gewohnte Gewissheit des Lesers – am Buchdeckel die Grenze von Realität zu Fiktion vorzufinden– zu erschüttern.Was als Biografie eines Antiquars beginnt, wird bald zu einer aufwühlenden, undurchsichtigen Parabel über die Radikalisierung eines Außenseiters – über einen bitteren Verlierer der Wende und der Digitalisierung. Dem Autor gelingt es mit großer Finesse, Schreiber und Leser gegeneinander auszuspielen und dabei die Erzählautorität in Frage zu stellen. Ein möglicher Schlüssel ist der oft verwendete Deckname Paulinis „Prinz Vogelfrei“. Dieser spielt auf ein Gedicht von Nietzsche an. Allein das Wort „vogelfrei“ vereint zwei konträre Erfahrungswelten: Neben der mittelalterlichen Ächtung steht es im Zeichen der Romantik für den Ausbruch aus dem bürgerlichen Alltag. Die Verbindung mit „Prinz“ ist nicht nur ein klassischer nietzscheanischer Gegensatz (denn ein Prinz ist alles andere als vogelfrei), sondern steht auch für die unerklärlichen Ambivalenzen des Protagonisten, der rechtsradikal und belesen, geächtet und gehuldigt wird.
So ist es eine Geschichte über die Frage, wie rechtschaffen die Literatur wirklich ist und wie – vermeintlich – wenig es braucht, um einen gewöhnlichen Mann in die rechte Ecke zu treiben. „Die rechtschaffenen Mörder“ ist ein Roman, der Grenzen der Glaubwürdigkeit auslotet und definitiv lange nachwirkt. Cornelia Braun
- Ingo Schulze:
Das Mädchen
Gewalt, Terror und Lebensmut. „Das Mädchen“ ist verstörend, wichtig und unbedingt lesenswert.

Copyright: Hoffmann und Campe Verlag
Eine Nachricht aus Nigeria erschütterte im April 2014 die Welt. 276 Schulmädchen waren aus einem christlichen Internat in Chibok im Nordosten des Landes von der islamistische Terrormiliz Boko Haram verschleppt worden. Monatelang fehlte von den Entführten jede Spur. Sechs Jahre später ist das Schicksal von mehr als 100 der jungen Mädchen noch immer ungeklärt. Lediglich 82 der „Chibok-Girls“ wurden 2017 nach Verhandlungen mit der nigerianischen Regierung von den Terroristen freigelassen, andere konnten schon vorher befreit werden oder aus eigener Kraft fliehen.
Doch wie ergeht es den jungen Frauen nach ihrer Rückkehr in den nigerianischen Alltag? Eine Frage, der Irlands bekannteste Autorin, die inzwischen 90 Jahre alte Edna O’Brien, nachgegangen ist. Drei Jahre lang hat sie für ihren eindrucksvollen Roman „Das Mädchen“ recherchiert und vor Ort mit betroffenen Frauen und deren Unterstützern gesprochen. Zwei mehrwöchige Reisen führten die Autorin 2016 und 2017 nach Nigeria, wo sie von Schicksalen erfuhr, die sie bis heute verfolgen. „Manchmal schrecke ich nachts hoch und denke an die Mädchen und das Schreckliche, was ihnen widerfahren ist“, sagte sie in einem Interview mit einer englischen Zeitung. „Doch ich konnte wieder nach Hause fahren. Die jungen Frauen werden bis an ihr Lebensende mit den Erinnerungen leben müssen.“
Im Zentrum des Romans steht Maryam, eine fleißige Schülerin mit großen Zukunftsplänen, die in jener Aprilnacht 2014 jäh zunichte gemacht werden. Eine Gruppe von Terroristen dringt in den Schlafsaal der Schülerinnen ein. Die verstörten jungen Frauen werden auf Lastwagen verfrachtet und in ein abgelegenes Camp gebracht, wo sie den Brutalitäten der „Gotteskrieger“ ausgeliefert sind. Maryam wird gegen ihren Willen mit einem der Kämpfer verheiratet. Erst Jahre später gelingt ihr mit ihrer kleinen Tochter Babby die Flucht. Eindringlich schildert Edna O’Brian den Alltag im Camp. Die Mädchen werden brutal misshandelt und vergewaltigt. Manche sterben im Kindbett, andere verlieren den Verstand. Auch Maryams physische wie psychische Gesundheit ist in Gefahr. Nachts träumt sie davon, ihren Peinigern die Schädel zu zerschmettern und sie bei lebendigem Leib in kochendes Wasser zu stoßen. Maryams Leidensweg ist nach ihrer Rückkehr nach Hause nicht zu Ende. In ihrem von Traditionen regierten Heimatdorf gilt die junge Mutter als „Busch-Ehefrau“ und Hure der Terroristen. Eine Tante nimmt ihr Babby, das Kind des Feindes, weg, eine Geistheilerin versucht, der traumatisierten Frau mit Wurzelsaft und rohen Eiern den Teufel auszutreiben.
Edna O’Brien erweist sich in ihrem 19. und vielleicht letzten Roman einmal mehr als eine streitbare Kämpferin für die Sache der Frauen. Bekannt wurde die Bauerntochter aus Westirland Anfang der 1960er Jahre mit der „Country-Girls-Trilogie“, die inspiriert war von ihrer eigenen Biografie. Die drei Romane über junge Frauen auf der Suche nach einem freien, selbstbestimmten Leben lösten im katholischen Irland einen Skandal aus und landeten prompt auf dem Index. Edna O’Briens Hauptfigur Maryam nimmt schließlich ihre ganze Kraft zusammen, um den Dämonen der Vergangenheit zu entfliehen und ihren eigenen Weg zu finden. Fernab von ihrem Heimatdorf, wo man sie die Vergangenheit nicht vergessen lässt. „Das Mädchen“ ist ein verstörendes, ein wichtiges, ein unbedingt lesenswertes Buch, das von Gewalt und Terror, aber vor allem von der Stärke und dem Lebensmut von Frauen erzählt. Petra Pluwatsch
- Edna O’Brien:

