Drei junge Chorleiter im GesprächKölner Chöre legen einen Höhenflug hin
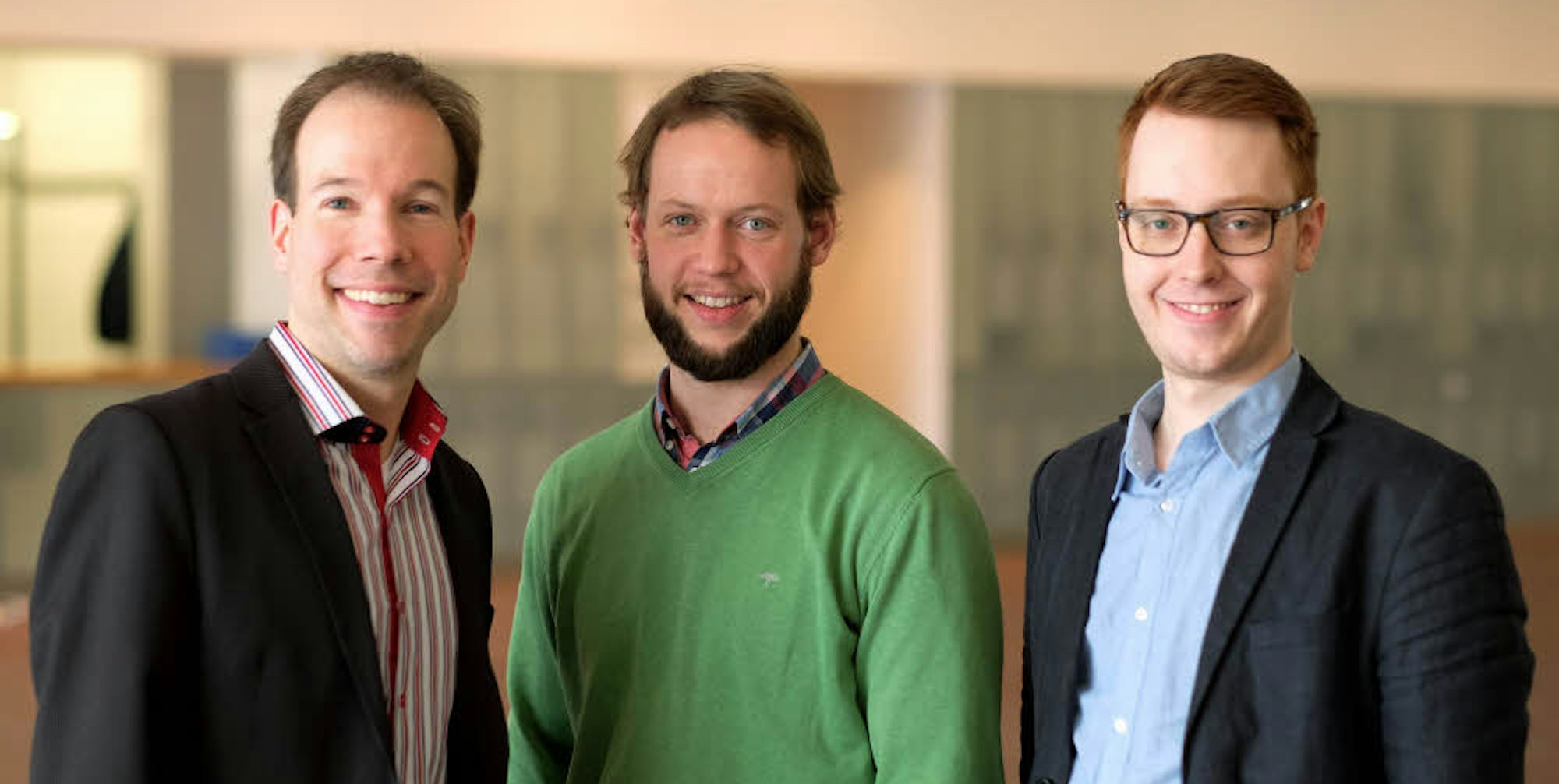
Optimistisch in die Zukunft: Georg Hage, Paul Krämer, Arndt Martin Henzelmann (von links)
Copyright: Max Grönert
Köln – Überbewerten wollen die drei Herren den Vorgang nicht, Arndt Henzelmann vom Oratorienchor und vom Rodenkirchener Kammerchor etwa nennt ihn einen „ganz natürlichen Prozess“. Aber auch ihnen ist bewusst, dass in der Kölner Konzertchorleiterszene in diesen Tagen und Jahren ein Generationswechsel stattfindet.
Der Außenstehende nimmt ihn wahr, wenn er – zum Beispiel – bei Pressekonferenzen des Netzwerks Kölner Chöre neue und junge Gesichter sieht: Urgesteine des hiesigen Chorlebens wie Horst Meinardus, Volker Hempfling und Peter Neumann haben sich zurückgezogen oder sind im Begriff, es zu tun. Statt ihrer dominiert die Riege der 30- bis knapp 40-jährigen: mit Henzelmann, Georg Hage (Kölner Kantorei) und Paul Krämer (Kartäuserkantorei).
Zu den Personen
Georg Hage, geboren 1979 in Halle (Westfalen), studierte Kirchen- und Schulmusik, Lied- und Konzertgesang, Orgel und Dirigieren. Er ist Kantor an der Aachener Annakirche und leitet mehrere Chöre, darunter seit 2015 die Kölner Kantorei.
Paul Krämer, geboren 1990, wuchs in Oberhausen auf und studierte in Köln zunächst Mathematik und Schulmusik, dann Chordirigieren. Seit 2013 leitet er die Kölner Kartäuserkantorei, seit 2016 den Bonner Philharmonischen Chor.
Arndt Martin Henzelmann, geboren 1987 in Berlin, studierte Kirchenmusik und Chordirigieren in Berlin und Köln. Seit 2017 ist er Leiter des Rodenkirchener Kammerchors und -orchesters, seit 2018 Leiter des Kölner Oratorienchors. (MaS)
Weil die Chöre selbstredend nicht mitausgetauscht werden, bedeutet dies, dass die neuen Leiter vor durchschnittlich deutlich älteren Choristen stehen. Die drei Musiker, die im Gespräch mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ über ihre Erfahrungen berichten, sehen auch diesen Umstand undramatisch: „Sicher wird“, gibt Krämer zu Protokoll, „genau hingeschaut, was der da vorne so macht, viele der Alteingesessenen kennen, aus früheren Aufführungen, ja auch mehr Chorwerke als man selbst.“ Das sei indes ein Erfahrungsschatz, der der Chorarbeit in hohem Maße zugute komme. Auf längere Sicht aber spiele, bestätigt Henzelmann, das Alter hüben wie drüben keine entscheidende Rolle, sondern es gehe allein um die fachliche Qualität und deren Akzeptanz.
Kaum noch institutioneller Rückhalt
Alles also wie gehabt? Nicht ganz. Georg Hage erwähnt, dass „im Netzwerk“ – das ist ein Zusammenschluss von Chören, die in wechselseitiger Programmabsprache die Kölner Chorkonzerte in der Philharmonie durchführen – „Chorleiter zusammenkommen, die sich auch vorher schon kannten, teils miteinander befreundet sind und gleichgerichtete Energien und Ideen haben“.
Und manches ist da in der Tat anders als früher: War einst die kirchenmusikalische A-Stelle an den Pfarreien, die Kantorenstelle also, weithin die institutionelle Basis des Chorlebens, so ist diese durch die Auflösung oder Herabstufung der entsprechenden Positionen erodiert. Von den drei zum Gespräch versammelten Chorleitern verfügt nur noch Hage als Kantor der Aachener Annakirche über einen entsprechenden „Anker“, Henzelmann und Krämer – der eine von Haus aus Kirchenmusiker und Chordirigent, der andere Schulmusiker und Chordirigent – sind „freie“ Leiter von „freien“ Konzertchören, die früher eine enge kirchliche Anbindung hatten, sie aber inzwischen verloren haben.
„Natürlich“, sagt Krämer, „ist das Fehlen des institutionellen Rückhalts ein Problem. Das betrifft die Probenräume, die Verankerung in der Gemeinde, auch die Finanzierung der Konzerte und des Chorleiters.“ Auf der anderen Seite ermögliche die „Säkularisierung“ die Öffnung hin zu einem breiteren, weltlichen Repertoire. Und die „Anzahl der am Singen interessierten Menschen“ werde davon sowieso nicht tangiert. Dieses Statement verdient insofern Interesse, als die drei Chorleiter aus ihrer Erfahrung heraus der These von einem Niedergang des klassischen Chorgesangs auf breiter Front vehement widersprechen. Von wegen „Singen ist uncool“. Universitätschöre, Landesjugendchöre, aber auch – entgegen anderslautenden Mutmaßungen – die florierenden Pop- und Jazzchöre stellten ein starkes Nachwuchsreservoir dar, seien jedenfalls keine schädliche Konkurrenz. „Die Grenzen sind fließend geworden“, konstatiert Hage, „und von seiner Ausbildung her muss ein moderner Klassik-Chorleiter auch einen Pop- oder Jazzchor leiten können.“
„Es gibt Chöre jeden Niveaus, da findet jeder seine Heimat.“
Davon abgesehen sei auch die soziale Integrationsfunktion von Chören nicht zu übersehen und zu unterschätzen: Wer als frisch Zugezogener noch fremd in einer Stadt sei, finde, so er denn Interesse am Singen hat, über einen Chor rasch Anschluss. So sei, sagt Henzelmann, „Singen ein großes Thema“, trotz der progressiven Individualisierung zwischen Genres und Ansprüchen auch in der Chorszene.
Der Boom des Chorgesangs scheint vorderhand erklärungsbedürftig auch angesichts der Tatsache, dass die ganze Sphäre in den vergangenen Jahrzehnten einen bemerkenswerten qualitativen Take-off hingelegt hat: „Gute Laienchöre von heute haben“, stellt Krämer fest, „das Niveau, das Profichöre vor 30 Jahren hatten.“ Schön und gut, aber werden durch diese Steigerung nicht auch Singwillige abgestoßen – denen spätestens beim Aufnahme-Vorsingen bedeutet wird: Ihr müsst leider draußen bleiben?
Nein, sagen Hage, Henzelmann und Krämer übereinstimmend: „Es gibt Chöre jeden Niveaus, da findet jeder seine Heimat.“ Hinzu kommt, dass heutzutage seitens der Chorleiter im Interesse der chorischen Qualitätsverbesserung auf Stimmbildung sehr viel mehr Wert als früher gelegt wird. Dieser Aspekt werde, so Hage, auch in der Hochschulausbildung zusehends stärker betont. Er gehöre mittlerweile zum „Handwerkszeug“ des Chorleiters.
Die Philharmonie ist vielen Chören zu groß
Und die Spezialensembles und professionellen Kammerchöre? Henzelmann: „Sie sind Vorbilder und Befeuerung, keine Konkurrenz.“ Hage: „Es funktioniert gut nebeneinander – selbst wenn die Spezialisten nicht mehr schwerpunktmäßig Uraufführungen, sondern auch und verstärkt Bach singen.“
Trotzdem bleibt die Frage, ob der Kuchen in einer ausgewiesenen Chorstadt wie Köln für die Konsumenten nicht zu groß ist. Sicher, meint Krämer, gebe es ein „riesiges Angebot“, und als Amateurchor die Philharmonie bis auf den letzten Platz füllen zu wollen, sei „ein sehr anspruchsvolles Unterfangen“. Diesbezüglich sei das Netzwerk eine segensreich-solidarische Einrichtung: „Da können wir riskieren, mit einem ausgefalleneren Programm auch mal nicht vor vollem Haus zu spielen.“ Leere Reihen müsse man „einpreisen“, die eigenen Erwartungen anpassen.
Zudem fehle in Köln auch eine adäquate räumliche Alternative – die Kirchen seien wegen ihrer Akustik halt problematisch. Tausend Zuhörer in der Philharmonie sind laut Henzelmann „nicht wenig“. Wenn trotzdem der Eindruck schlechten Besuchs entstehe, dann deshalb, „weil der Raum zu groß ist“.
Köln habe halt kein „Pendant zum Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie, keinen mittleren Konzertsaal für rund 700 Zuhörer“. Der verbreiteten Forderung nach einem einschlägigen Raumangebot in und für Köln können sich die drei Chorleiter jedenfalls vorbehaltlos anschließen.
