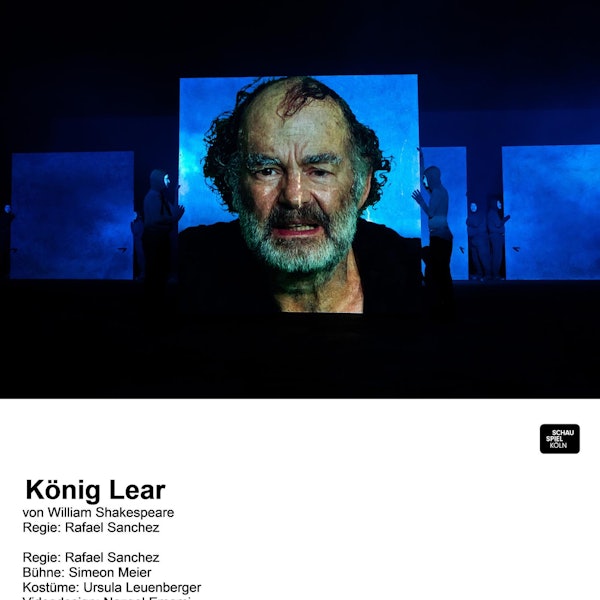Uraufführung am Schauspiel KölnEin Abend wie vom denkfaulen Zeitgeist bestellt

Yuri Englert in Love Me More
Copyright: Birgit Hupfeld
Köln – Am Anfang liegt der antike Narziss in doppelter Gestalt auf der spiegelglatten Bühne, auf ewig dazu verdammt, sich im eigenen Antlitz zu verfangen. Seine beiden Darsteller, Campbell Caspary und Breeanne Saxton, wälzen sich und bäumen sich auf, nackt wie der moderne Theatergott sie schuf, und fallen doch immer wieder flunderflach auf den Boden und in den Bann der eigenen Schönheit zurück. Selbst die Gnade, im spiegelnden Wasser zu versinken, bleibt diesem zweigeschlechtlichen Mythos verwehrt – ach, Selbstliebe kann so grausam sein.
Saar Magal widmet sich mit Oscar Wilde dem modernen Narzissmus
„Love Me More“, liebe mich mehr, fordert Saar Magal in ihrem gleichnamigen „Crossover-Projekt“, mit dem sich die israelische Choreografin dem auf Selbstoptimierung und Leistungsbereitschaft getrimmten Narzissmus unserer spätkapitalistischen Zeiten widmet. Liebe ist in dieser Welt allerdings nur ein Wort, alles hat im Depot 1 seinen Nutz- und Tauschwert, nichts scheint wahrhaftiger als das eigene Image, und im alltäglichen Konkurrenzkampf ist Härte gefragt. Folgerichtig hängt der Bühnenhimmel des Schauspiels Köln voller Sandsäcke, weil die narzisstische Gesellschaft ein verspiegelter Boxring ist. Oder eine Castingshow mit Donald Trump als oberstem Juror.
Magals erster Gewährsmann ist freilich Oscar Wilde, auf dessen Roman „Das Bildnis des Dorian Gray“ sich die Uraufführung beruft. Yuri Englert verleiht einem in kardinalsrote, schulterfreie Kleider gewandeten Chor die Wilde’sche Stimme der narzisstischen Vernunft: Warum kann ich nicht ewig jung bleiben, während mein Bild an meiner Stelle altert? Einen langen Augenblick sonnt sich das neunköpfige Ensemble in der Illusion dieser schönen Fantasie, dann fällt einer aus der selbstverliebten Phalanx zurück, beginnt am ganzen Körper zu zittern, zu taumeln, er stürzt, spürt womöglich das Gewicht des Alterns, die Krankheit zum Tode – oder hat einfach nur ein Überdosis leistungssteigernder Wunderpillen eingenommen.
Das könnte Sie auch interessieren:
Jedenfalls läutet sein Zusammenbruch das Rennen um die Sandsäcke ein, jeder und jede schnappt sich einen und setzt ihn als Waffe gegen den nächsten ein, dazu peitschen Donnerschläge oder Gewehrsalven aus den Lautsprechern – nach zehn von 90 Minuten hat Magal ihre Gute-Nacht-Botschaft erfolgreich unters Publikum gebracht. Keine schlechte Leistung, nennen wir es Selbstoptimierung des Theaters. Allerdings geht es dann eben noch weiter im Cross-Over-Prinzip: mit einer wie vom denkfaulen Zeitgeist bestellten Nummernrevue, akrobatischen Tanztheatereinlagen vor Videoleinwänden, Textzitaten aus der glamourösen Schauermärchenwelt der Wall Street und, man lese und staune, der Einsicht, dass der moderne Narziss die Einsicht in die eigene Vergänglichkeit mit Geld, Drogen und sogar ein bisschen Sex bekämpft.
Wobei die Figuren viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, um noch auf andere geil zu sein. Alles ist, siehe oben, ein geld- oder wenigstens sozialprestigewertes Tauschobjekt, also auch der Austausch von Körperflüssigkeiten – und im Zweifelsfall ist der narzisstische Mensch seinesgleichen kein sekundäres Geschlechtsorgan, sondern ein Ellenbogen. Ganz hübsch zeigt Magal das bei der Erstbesteigung des goldenen Bergs: Während Yuri Englert uns mit einer Erzählung vom reichen Erben die Krokodilstränen in die Augen treibt, robben die Darsteller auf dem Bühnenboden einen imaginären Gipfel hinauf, kämpfen um den Spitzenplatz und stürzen dabei immer wieder sehr ansehnlich mit Purzelbäumen in die Bühnentiefe.
Jemima Rose Dean prostituiert sich lieber an der Pole-Dance-Stange als im Schwanensee
Komischerweise kommen die Reichen und die Managertypen auch sonst nicht gut weg – jedenfalls in der sattsam bekannten Hollywood-Version. Rebecca Lindauer hält eine „Gier ist gut“-Rede, während sie auf einem rollenden Sandsack balanciert und ihrer Videodoppelgängerin das Blut aus der Nase rinnt; Yuri Englert spielt ein bisschen Wolf der Wall Street, obwohl er rein äußerlich als beilschwingender Patrick Bateman besser aufgehoben wäre; und das in blaue Glitzeranzüge gesteckte Ensemble feiert zu Stroboskoplicht eine harte Party, nachdem es zuvor hart an Trimmdichgeräten gearbeitet hat.
Leider wird es in den unteren Gehaltsklassen nicht besser. Alexander Angeletta legt als sein fiktives Selbst etwas hin, was wohl eine Mischung aus Vorstellungsgespräch und Seelenstriptease sein sollte, macht sich dabei aber schneller nackig, als man mit der Wimper zucken kann. Jemima Rose Dean wiederum darf an der Pole-Dance-Stange davon berichten, dass sie sich lieber als ihre eigene Herrin prostituiert anstatt als Ballettensemble-Entlein im Schwanensee. In solchen Momenten ahnt man etwas Menschliches hinter der Fassade und sucht doch vergeblich nach der Traurigkeit im Selbstbetrug. Mag ja sein, dass der selbstoptimierte Narziss der neuste Trick des Kapitalismus und Selbstliebe eine Form von Selbstausbeutung ist. Aber wird man ihm mit lauter Abziehbildern gerecht?
Am Ende hüpfen alle ins Wasser, was beinahe wie eine wohlverdiente Erlösung wirkt. Der schüttere Applaus schwankte zwischen aufmunternd und Weckruf für den dösenden Verstand.
„Love Me More“, Regie und Choreografie: Saar Magal, Schauspiel Köln, Depot 1, 90 Minuten. Nächste Termine: 25., 26., 30. Oktober, 3. November.