Konkurrenz für BASFChina entwickelt den weltweit größten Chemie-Konzern
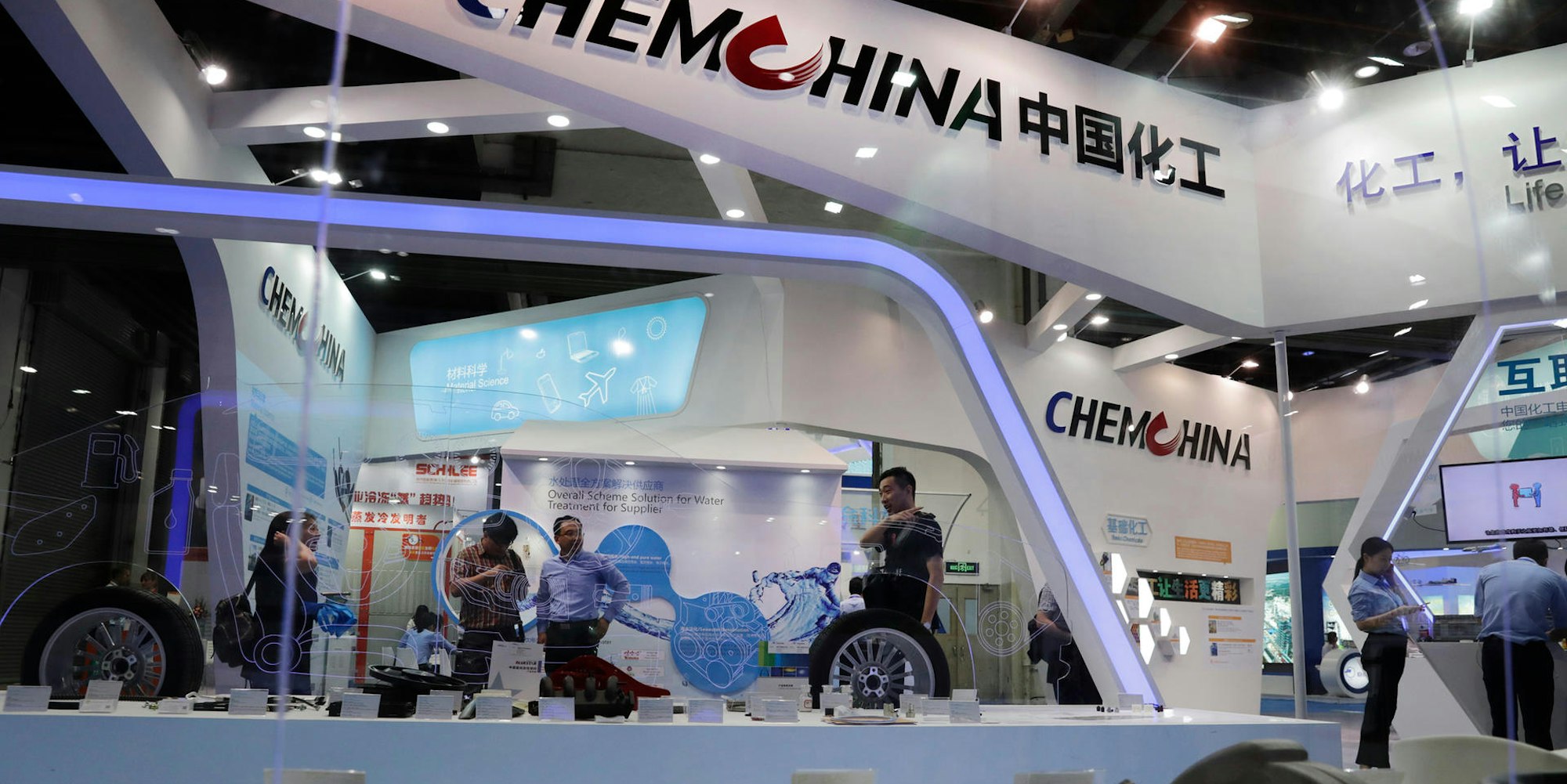
Die chinesischen Chemie-Giganten Chemchina und Sinochem stehen vor der Fusion zum weltweit größten Chemie-Konzern.
Copyright: AP
Peking – Bisher ist die BASF aus Ludwigshafen das größte Chemieunternehmen der Welt – vor dem US-Konkurrenten Dow Chemical. Doch die chinesische Regierung fädelt gerade eine Verschmelzung ein, die einen noch zweimal größeren Wettbewerber schaffen würde. Die Großkonzerne ChemChina und Sinochem könnten auf politischen Druck hin ihre Geschäfte zusammenzulegen, wie in Peking zu hören ist. Der gemeinsame Umsatz würde die Marke von 100 Milliarden Euro überschreiten, wenn zudem noch eine Reihe von hochkarätigen Zukäufen verdaut ist.
Firmen-Fusion ist chinesischer Trend
Die chinesische Regierung organisiert derzeit gezielt die Zusammenlegung von konkurrierenden Staatsbetrieben zu wettbewerbsfähigeren Großunternehmen. Sie hat bereits die Stahlgiganten Baosteel Group und Wuhan Iron and Steel verschmolzen. Das neue Unternehmen heißt jetzt Baowu Steel und ist das zweitgrößte seiner Art nach Arcelor Mittal aus Luxemburg. Auch der weltgrößte Eisenbahnhersteller CNR ist durch so eine Fusion entstanden.
Parallel dazu kaufen die Unternehmen Wettbewerber auf dem Weltmarkt zu. Von besonderem Interesse ist hier die Übernahme des Schweizer Agrarchemiespezialisten Syngenta für 43 Milliarden Dollar durch Chemchina. Der Zukauf hat gerade die Zustimmung der Aktionäre erhalten. Syngenta wäre von Anfang an Teil des neuen Riesenkonzerns, wenn die Fusion stattfindet wie angedacht.
Die Chemie gilt als enorm wichtiges Feld für die weitere Entwicklung in China – neue Materialien spielen eine Rolle für Energieeinsparungen in Bau und Industrie. Für fortschrittliche Produkte für den In- und Auslandsmarkt ist es ebenfalls wichtig, Zugriff auf neueste Technik zu haben. Der Agrarchemie kommt eine Schlüsselrolle bei der Modernisierung und Effizienzsteigerung der Landwirtschaft zu.
Von Problemen geplagt
Doch zugleich werden Zweifel laut, ob „groß“ auch immer „gut“ ist. „Das Leben beginnt nach dem Geschäftsabschluss“, sagt Anwältin Grace Fan-Delatour von der Kanzlei K&L Gates der amerikanischen Zeitung „Wall Street Journal“. Fan-Delatour berät chinesische Staatsbetriebe bei Auslandsübernahmen. Große Fusionen und Übernahmen seien oft von Problemen geplagt, warnt die Expertin. Syngenta war zuletzt nicht profitabel und stand deshalb zum Verkauf. Der Kauf durch die Chinesen würde zwar einen riesigen Absatzmarkt eröffnen, die Schwierigkeiten jedoch nicht beseitigen.
Die treibende Kraft hinter der Expansion ist Ren Jianxin, der Chairman von Chemchina. Ren hat bereits die Übernahme des italienischen Reifenherstellers Pirelli durchgezogen. Nun wird sein Unternehmen selbst zum Partner einer von außen eingefädelten Übernahme. Die Chefs von Chemchina und Syngenta haben bis vor kurzem geleugnet, dass eine Zusammenlegung möglich sei. Ren hatte die Syngenta-Übernahme angeschoben, ohne sich mit den staatlichen Aufsehern ausreichend abzusprechen und sich damit wohl Feinde geschaffen.
Führungsfrage noch unklar
Derzeit ist unklar, welche Rolle Ren nach der Fusion spielen würde. Denn auch Sinochem hat einen ehrgeizigen Chef: Ning Gaoning ist ein rühriger Macher und gehört zur chinesischen Wirtschaftsprominenz. Er hat erst im vergangenen Jahr den Top-Posten bei Sinochem übernommen. Welcher der beiden Alpha-Manager am Ende das Großkonglomerat führt, muss vermutlich die Politik entscheiden.
Sinochem gilt als schwerfälliger, ineffizienter und bürokratischer als Chemchina. Andererseits ist Sinochem weit weniger verschuldet als Chemchina nach seiner globalen Einkaufstour. Auch das könnte eine Motivation für die Zusammenlegung sein: Chemchina dürfte Schwierigkeiten haben, die Folgekosten der Syngenta-Übernahme zu stemmen. Zusammen mit der finanziell besser ausgestatteten Sinochem dürfte es besser laufen. Beide Firmen sind Staatsbetriebe, doch Ren hat das Unternehmen im Geist einer Privatfirma gegründet und sie straff geführt. An beiden Unternehmen hängt bereits eine Vielzahl von Tochtergesellschaften mit allerlei Querbeteiligungen.
Westliche Unternehmen geben sich unbesorgt
Sinochem und Chemchina waren seit ihrer Gründung Rivalen: Die Unternehmen haben sich auf sehr ähnlichen Geschäftsfeldern getummelt. Mit der Fusionswelle in der chinesischen Großindustrie kehrt sich zum Teil ein Trend aus den 90er-Jahren um: Damals hat Premier Zhu Rongji absichtlich Konkurrenten geschaffen, damit der Wettbewerb bessere Preise und Dienste hervorbringt.
Bei der Freigabe des Telekom-Marktes hat er beispielsweise zwei staatliche Telefonanbieter schaffen, um keine Monokultur zu bekommen. Heute fragen sich die staatlichen Wirtschaftslenker umgekehrt, warum verwandte Firmen in so vielen Bereichen Doppelarbeit leisten, wenn auch eine effektive Bündelung möglich wäre.
Westliche Industrievertreter bezweifeln, dass die reine Zusammenlegung für sie viel ändert. Ob die chinesische Chemieindustrie von einem oder zwei großen Spielern repräsentiert ist, verändere nicht die Regeln, sagt ein deutscher Chemie-Manager. Als im vergangenen Jahr erstmals Gerüchte von der Fusion der beiden Firmen aufkamen, ist der Aktienkurs gestiegen, weil Investoren auf bessere Absatzchancen auf dem Weltmarkt und Kostensenkungen bei Forschung und Produktion hofften.

