Corona in Köln„Kinder müssen zu aller erst von Lockerungen profitieren“

Schülerinnen und Schüler sollen dem Präsenzunterricht nur noch im Extremfall fernbleiben müssen.
Copyright: Getty Images/iStockphoto
- Medizinisch sind Kinder und Jugendliche kaum von der Corona-Pandemie betroffen – sozial dafür umso härter.
- Davon sind Prof. Jörg Dötsch, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin, und Prof. Stephan Bender, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, überzeugt.
- Im Interview sprechen die Kölner Mediziner über physische und psychische Folgen, eine Corona-Impfung für Kinder und die Wichtigkeit des Präsenzunterrichts.
Herr Dötsch, Herr Bender, wie viele Kinder sind in Deutschland bislang an Covid-19 gestorben?Prof. Jörg Dötsch: Todesfälle bei Kindern sind extrem selten. Je nachdem, von welchen Daten man ausgeht, sind in Deutschland bis zu zwölf Kinder an Covid-19 gestorben, eindeutig an der Krankheit vier. Bei der Grippe waren es im vergangenen Jahr neun Kinder.
Lässt sich überhaupt sagen, dass das Virus Kinder medizinisch betrifft?
Dötsch: Unbedingt, die Todesfälle sind ja nur das eine. Die überschießende Reaktion des Immunsystems kann auch Kinder betreffen. Auf unserer Station an der Uniklinik hatten wir zehn Fälle, in Deutschland gehen wir von rund 250 dieser Verläufe aus. Wir können sie mit Medikamenten aber recht gut behandeln. Das dritte ist LongCovid.
Prof. Stephan Bender: Ja, doch wir wissen zu den Langzeitfolgen bei Kindern bislang viel zu wenig. Wir beobachten in relativ vielen Fällen unspezifische Symptome: Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Stimmungsschwankungen und Dauermüdigkeit, auch nach leichten Verläufen. Hier besteht aber gerade im Hinblick auf psychosomatische Langzeitfolgen noch ein großer Untersuchungsbedarf, auch mit Blick auf die Mutationen.
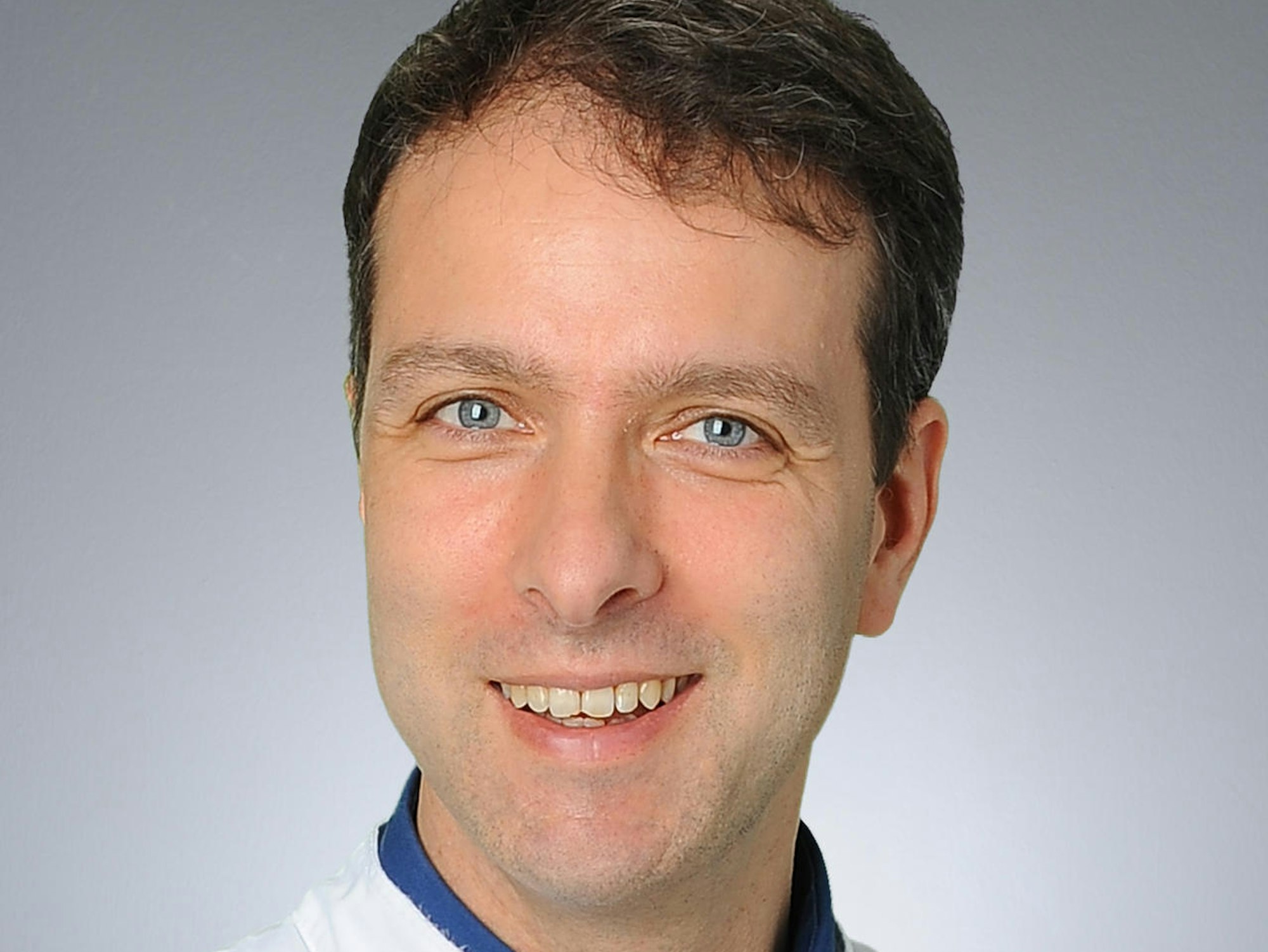
Prof. Jörg Dötsch
Copyright: MedizinFotoKoeln
Dötsch: Deutschlandweit entsteht hier gerade ein genaueres Bild. Gemeldete Fälle werden verfolgt und ausgewertet. Das dauert aber eben noch einige Monate – hierin spiegelt sich ein Kernproblem dieser Pandemie: Wissenschaftliche Prozesse benötigen Zeit, die wir schlicht nicht immer haben. Was wir sicher wissen: Covid selbst löst bei Kindern in vielen Fällen nur leichte Erkältungen aus, in wenigen Fällen kommt es zu Störungen bei Geruch oder Geschmack. Ausgeprägte Atemprobleme sind sehr selten. Schwere Verläufe, die auf der Intensivstation enden, noch viel seltener.
Das Risiko ist also vergleichsweise gering, das Leben junger Menschen wird seit rund 14 Monaten dennoch auf den Kopf gestellt. Ist das nicht ungerecht?
Bender: Absolut. Insbesondere vor den Mutationen waren Kinder und Jugendliche medizinisch kaum von der Pandemie betroffen, sozial dafür umso härter. Für sie lässt sich sozialer Kontakt über Telekommunikationsmittel kaum kompensieren. In unserem beruflichen Alltag ist das anders: Wir würden zwar gerade sicher lieber bei einem Kaffee zusammensitzen, kommen aber auch mit einer Videokonferenz zurecht. Jüngere Kinder tun das grundsätzlich eher nicht. Bei ihnen läuft Kommunikation mehr nonverbal und taktil, weniger kognitiv. Kindliche Kommunikation funktioniert also gewissermaßen nur im direkten Miteinander.
Was hilft Kindern, unbeschadet durch diese Pandemie zu kommen?
Bender: Viele sitzen wie eingeschlossen in den eigenen vier Wänden. Mit Garten und Geschwistern ist das selbstredend deutlich angenehmer als in engen Räumlichkeiten und alleine. Je besser die Eltern ausgestattet sind, sie mit den organisatorischen Herausforderungen klarkommen und in der Lage sind, Tagesstrukturen aufrechtzuerhalten, desto besser geht es den Kindern. Das ist eindeutig. Wir haben im vergangenen Jahr eine klare Korrelation gefunden zwischen psychischen Problemen bei Kindern und ihrer Wohnsituation. Das Umfeld ist absolut entscheidend.
Was genau geht Kindern durch unsere aktuelle Lebensweise verloren?

Prof. Stephan Bender
Copyright: Michael Wodak
Bender: In jedem Alter der Kindheit und Jugend gibt es unterschiedliche Entwicklungsaufgaben, die zu bewältigen sind. Sie alle werden durch die Pandemie massiv erschwert. Sprache als Kommunikationsfähigkeit differenziert sich im Miteinander immer mehr aus. Gibt es eine gute Abdeckung innerhalb der Familie, muss das keine gravierenden Folgen haben. Aber: Viele Kinder haben überhaupt keinen Ersatz für den Kontakt mit Gleichaltrigen. Das kann die Entwicklung deutlich beeinträchtigen. Bei den Jugendlichen beobachten wir hingegen mehr affektive Störungen, man kann sagen: Das Virus verstärkt die Ausprägungen der Pubertät. Die Stimmung ist bei vielen Teenagern labiler. Bei jungen Kindern sehen wir Konzentrationsschwierigkeiten, sie rasten häufiger aus und sind oft wütend. Es gibt natürlich auch junge Menschen, die jetzt besonders gut klarkommen. Manche Kinder mit ADHS oder Autismus etwa, denen Homeschooling häufig sehr gut liegt. Aber das sind Ausnahmeerscheinungen.
Seit dem vergangenen Herbst wechseln Schulen ständig vom Distanz- in den Präsenzunterricht und umgekehrt. Wären klare Öffnungsperspektiven nach längeren Schließungen nicht sinnvoller als das ständige Justieren?
Dötsch: Nein. Es ist entscheidend, dass Lehrerinnen und Lehrer die Schüler gelegentlich sehen. Auch aus medizinischen Gründen. Lehrer entdecken oft sehr schnell Verhaltensauffälligkeiten, dafür sind sie geschult. Wenig Präsenzunterricht ist für Kinder und Jugendliche deutlich besser als keiner. Es gibt in den Familien auch riesige Kollateralschäden, die wir durch differenziertes Handeln abmildern können. Kinder reagieren besonders häufig körperlich auf psychische Probleme und umgekehrt – wir müssen also sehr genau hinschauen, was die Situation mit ihnen macht. Dafür hilft jeder Tag an der Schule.
Bender: Unwägbarkeiten sind durchaus ein Problem, das gilt für Kinder ebenso wie für Erwachsenen. Doch ich persönlich bin froh, dass wir zumindest ab und zu Präsenzunterricht durchführen. Teilweise wurde allerdings auch überlegt, Klassen für den Wechselunterricht zu vierteln – wodurch Lehrer keine Zeit mehr für Distanzunterricht hatten. Das ist natürlich suboptimal, hier braucht es mehr Einheitlichkeit. Grundsätzlich freue ich mich aber über jede Präsenzmöglichkeit, die Lehrerinnen und Lehrer schaffen.
Neues Centrum für Familiengesundheit
An der Uniklinik Köln wird das „Centrum für Familiengesundheit (CEFAM)“ zur Krankenversorgung für Eltern und Kinder auch räumlich in einem Gebäude zusammenwachsen – dort, wo aktuell das Infektionsschutzzentrum aufgebaut ist. „Wir wollen das Psychosoziale und das Körperliche an diesem Zentrum endlich zusammendenken“, sagt Bender: „Das wird auch nach der Pandemie essenziell sein.“ Das Ziel: Familien sollen die Möglichkeit der interdisziplinären Gesundheitsförderung bekommen. Dötsch betont: „Die meisten medizinischen Einrichtungen sind ärztlich geleitet. Unsere Leitung ist bewusst pflegerisch und ärztlich gestaltet.“ (red)
Wie ist eine langfristige Rückkehr in den normalen Unterrichtsbetrieb möglich?
Dötsch: Eine wichtige Lösung sind Teststrategien. Wir haben an der Uniklinik gemeinsam mit der Stadt Konzepte für Lolli-Tests mit der Pool-Methode an Klassen erarbeitet, die jetzt in ganz NRW angewandt werden – zumindest an Grund- und Förderschulen. Wir erhalten auch darüber hinaus Anfragen für diese Tests, bis nach Südtirol. Das zeigt: Mit kreativen Testmethoden können wir einen echten Unterschied machen. Mit der Pool-Methode gibt es bei positiven Tests keine Stigmatisierung unter den Schülern, auch ist die Anwendung sehr simpel. Das sind im Schulalltag große Vorteile.
Auch Impfungen spielen eine große Rolle, wenn es um Öffnungen geht. Wurden Kinder hier im politischen Diskurs zu lange ausgeklammert?
Dötsch: Nein, das Vorgehen ist aus meiner Sicht sehr verantwortungsvoll – auch, wenn es gelegentlich völlig anders wahrgenommen wird. Kinder und Jugendliche bedürfen eines besonderen Schutzes. Es ist gesetzlich festgelegt, dass Medikamente zunächst bei Erwachsenen erprobt werden. Das ist aus meiner Sicht genau richtig. Für Kinder kommt eine besondere Bedingung hinzu: Jede Impfung muss zwingend einen unmittelbaren Eigennutzen erbringen, ein epidemiologischer Nutzen reicht längst nicht. Es ist komplizierter, diesen Nutzen bei einer Gruppe nachzuweisen, die wesentlich weniger unter den gesundheitlichen Folgen von Covid-19 leidet.
Bender: Ich stimme zu, doch bei der Risiko-Nutzen-Bewertung müssen auch soziale Folgen berücksichtigt werden. Der Schulbesuch ist ein Eigennutzen, den es zu berücksichtigen gilt. Auch mögliche Spätfolgen einer Corona-Infektion bei Kindern und Jugendlichen müssen mitgedacht werden – glücklicherweise passiert all dies auch.
Dötsch: Ja, in der Ständigen Impfkommission sitzen auch Kinderärzte, ich halte das für sehr wichtig. Wir dürfen nichts tun, was Kindern schadet.
Das könnte Sie auch interessieren:
Es dauert also nur so lange mit den Kinder-Impfungen, weil die nachweisbare Gefahr nicht groß genug ist?
Dötsch: Natürlich wäre die Situation eine andere, wenn Kinder ebenso schwer von Covid-19 betroffen wären wie Erwachsene. Dann müssten wir bei den Impfungen mehr Risiken in Kauf nehmen. Zum Glück ist das hier nicht der Fall, wir richten uns uneingeschränkt nach den Regeln, die allgemein für Impfungen gelten. Ich begrüße das sehr.
Verstehen Kinder Ihrer Beobachtung nach, warum Sie Ihre Freunde auch nach mehr als einem Jahr kaum treffen dürfen?
Bender: Naja, wir sehen zumindest eine erstaunliche Resilienz. Viele Kinder sind sich der Lage sehr bewusst und nehmen sie an. Die Logik ist oft: Ich muss das jetzt machen, damit Oma und Opa nichts passiert. Darüber hinaus ist der konkret spürbare Bezug zu dieser Pandemie oft relativ klein – Kinder können weniger gut abstrahieren, das muss man berücksichtigen. Dafür ist ihr Verständnis insgesamt erstaunlich groß. Das heißt aber nicht, dass es keine Kinder und Jugendlichen gibt, die einfach nicht mehr können oder im Gegenteil Infektionsschutzregeln aus jugendlichem Leichtsinn missachten.
Wie können Kinder und Jugendliche aus Ihrer Sicht für das vergangene Jahr, dessen Verlauf auch mit politischen Scheitern in der Pandemiebekämpfung zu tun hat, entschädigt werden?
Dötsch: Die Kinder haben einen sehr, sehr hohen Preis gezahlt. Ihre Entwicklung wurde durch das vergangene Jahr massiv beeinträchtigt. Deswegen müssen sie zu aller erst von Lockerungen profitieren. Wenn wir in vier Wochen so viel geimpft haben, dass die Ansteckungen entscheidend zurückgehen, sollten wir alles daran setzen, die Schulen wieder langfristig zu öffnen. Auch, wenn sich Erwachsene dafür in anderen Bereichen weiter zurücknehmen müssen. Wir sind den Kindern etwas schuldig. Wir sollten uns dafür auch individuell bewusst zurücknehmen. Das Übertreten der Maßnahmen ist kein Kavaliersdelikt, es gefährdet uns alle – und es schränkt die Jüngsten letztlich unnötig ein.
Bender: Diesen Punkt möchte ich sehr unterstützen. Kinder haben keine Lobby, ihnen muss auch deshalb gerade jetzt, wo Öffnungen bevorstehen, eine besondere politische Aufmerksamkeit zukommen.
Ist auch die Politik den Kindern etwas schuldig, muss sie jetzt Aufhol-Programme schaffen?
Bender: Eine gewisse Bringschuld gibt es schon. Es sollte allerdings niemand die Anforderung stellen, dass Kinder den Lernrückstand aufholen müssen, das würde den Druck nur weiter erhöhen und kann auch kontraproduktiv sein. Es muss um passende Angebote und Hilfestellungen gehen.
Dötsch: Ich stimme zu. Doch wichtiger noch als die Suche nach einem Ausgleich ist es, weiteren Schaden zu verhindern. Die zentrale Frage muss lauten: Wie bringen wir den regulären Schulbetrieb, den Kinder dringend brauchen und der soziale Ungleichheiten abmildert, schnellstmöglich zurück? Es gilt, daran zu arbeiten.



