Corona in KölnWarum Kinder und Jugendliche in der Krise bisher vergessen wurden

Medizinisch sind Kinder und Jugendliche kaum von der Corona-Pandemie betroffen – sozial dafür umso mehr.
Copyright: getty images/KStA-Montage
- Medizinisch sind Kinder und Jugendliche kaum von der Corona-Pandemie betroffen – sozial dafür umso härter.
- Aber weswegen wurden sie bislang in der Corona-Krise dennoch vergessen? Und verhalten sich die Alten unsolidarisch den Jungen gegenüber?
- Darüber diskutieren Werner Spinner, ehemaliger Präsident des 1. FC Köln, und Prof. Jörg Dötsch, Leiter die Klinik für Kinder und Jugendmedizin an der Uniklinik Köln.
Herr Spinner, Ihnen bereitet die Situation der jungen Menschen in der Corona-Krise große Sorgen. Inwiefern?Werner Spinner: Ich sehe, wie Kinder und Jugendliche in der Pandemie vergessen worden sind. Ich habe vier Kinder und vier Enkelkinder. Ich kann das also aus eigener Erfahrung sagen, obwohl es denen vergleichsweise gut geht. Eltern und Kinder kommen in der Politik meistens gar nicht vor, und wenn, dann in der Form von Lippenbekenntnissen. Das muss sich rapide ändern, der Schaden ist ja schon eingetreten.Herr Prof. Dötsch, Kinder und Jugendliche haben in den vergangenen Monaten einen hohen Preis bezahlt, obwohl sie laut Studien keine Treiber des Infektionsgeschehens sind. Noch immer dürfen sie ihre Freundinnen und Freunde nicht so sehen, wie sie es gerne würden, Sport ist nur eingeschränkt möglich, der Unterricht findet mal auf Distanz und mal im Wechsel statt. Was sind hierbei die gravierendsten Auswirkungen?
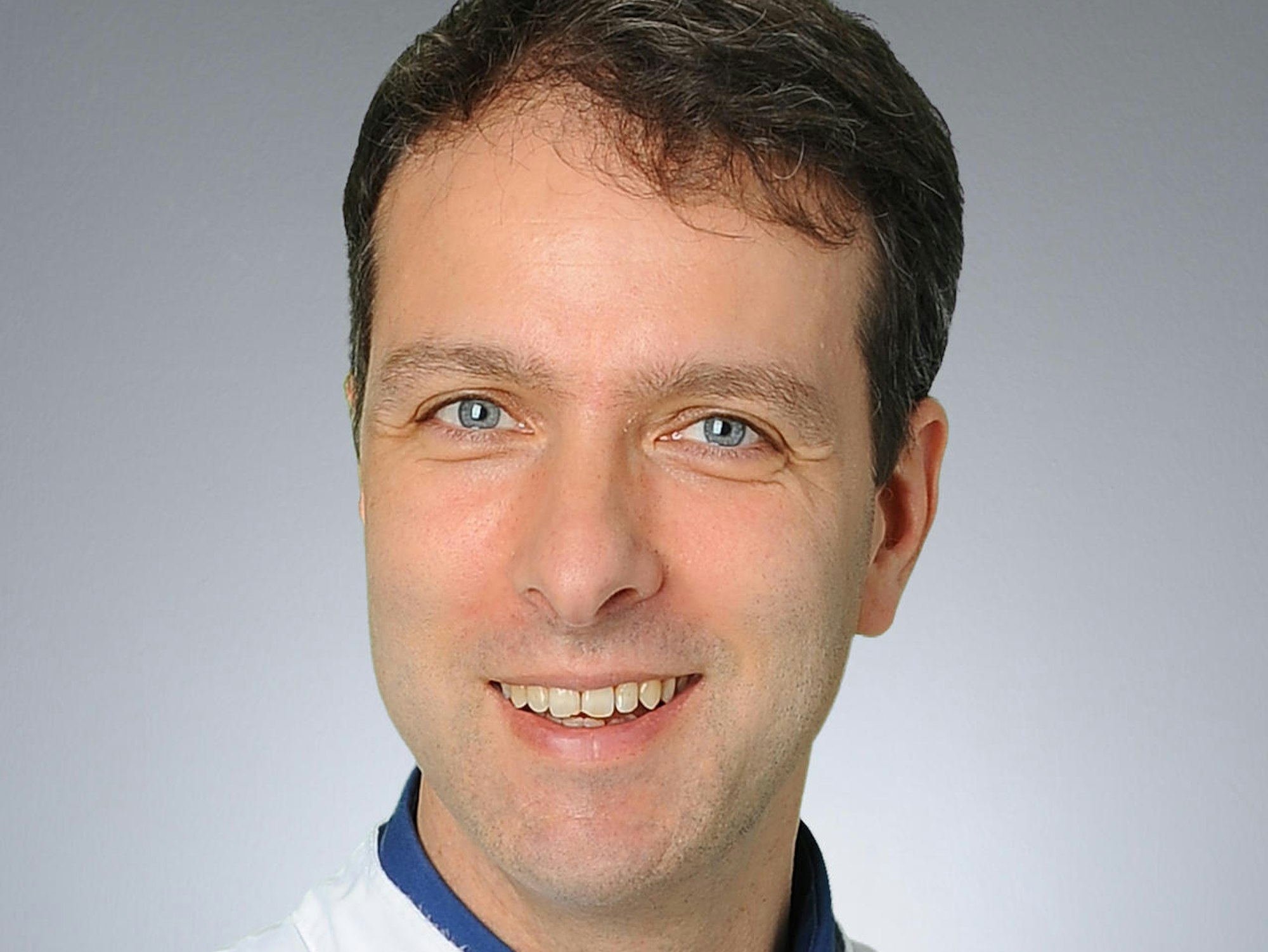
Prof. Jörg Dötsch
Copyright: Michael Wodak
Prof. Jörg Dötsch: Wir erleben, dass sich die Kinder und Jugendlichen aufgrund der fehlenden Kontakte und aufgrund des fehlenden Schulbesuches immer häufiger zurückziehen, traurig und antriebslos werden, in gewisser Weise vereinsamen. Wir haben auch deswegen ganz große Sorgen, weil diejenigen, die eine solche Veränderung erkennen können, die Lehrkräfte, die Erzieherinnen und Erzieher, nicht wie gewohnt präsent sein können und daher nicht sehen, wie es den Kindern geht. Um einmal Zahlen zu nennen: Vor der Pandemie fühlten sich etwa 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen emotional beeinträchtigt. Während der ersten Welle ist das dann auf 50 Prozent angestiegen und mittlerweile sind es 70 bis 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen.
Jakob Maske, der Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendkliniken, hat gesagt, die Kinder- und Jugendpsychiatrien seien voll, dort finde eine Triage statt. Das klingt sehr dramatisch…
Dötsch: Der Satz drückt eine große Sorge aus. Es ist aber so, dass die Kinder- und Jugendpsychiatrien nach wie vor komplett handlungsfähig sind. Die Kinder- und Jugendpsychiatrien sowie -pädiatrien arbeiten sehr gut zusammen. In Köln haben wir beispielsweise das Centrum für Familiengesundheit, einen Zusammenschluss der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Kinder- und Jugendklinik sowie der Geburtshilfe und weiteren Partnern. Wir helfen uns gegenseitig und sorgen dafür, dass auch bei Engpässen kein Kind durch die Maschen fällt.
Sie sagen, viele Kinder seien traurig. Beobachten Sie auch eine Zunahme von depressiven Kindern und solchen mit Suizidgedanken?
Dötsch: Ja, exakt. Traurigkeit ist natürlich eines der möglichen Symptome von Depressionen. Oft ist es auch Zurückgezogenheit, manchmal sind es körperliche Symptome wie etwa Bauchschmerzen, die sich bemerkbar machen. Wir haben eine Anfrage beim statistischen Bundesamt gestellt, ob dort vermehrte Suizidhäufigkeit gesehen wird. Zum Glück wurde uns das bisher nicht bestätigt – aber es wurde auch nicht dementiert. Wir können dazu im Moment also keine verlässliche Aussage treffen.
Herr Spinner, haben Sie sich bislang mit dem Coronavirus infiziert?
Spinner: Nein, ich habe Glück gehabt und mich natürlich an alle Auflagen, wie etwa eine Maske zu tragen und Kontakte zu reduzieren, gehalten.
Führen Sie das auch auf die junge Generation zurück, die ihr Leben in weiten Teilen umgestellt hat, um Gefährdete zu schützen?
Spinner: Ja, das ist genau der Punkt. Die Jüngeren haben uns Ältere geschützt, deswegen aber auch sehr gelitten. Ich bin der Generation sehr dankbar. Aber politische Priorität genießen sie nicht. Das ärgert mich sehr, denn das ist keine Art, ein alterndes Land zu führen. Die Zukunft hängt an den Kindern und Jugendlichen, und genau die lassen wir hängen. Deswegen müssen wir in der nächsten Zeit vieles wieder gut machen und ein Zeichen setzen, dass wir sehr wertschätzen, dass die Jungen uns Alte geschützt haben.

Werner Spinner
Copyright: Max Grönert
Was könnten die Älteren denn tun, um sich ein Stück weit solidarisch gegenüber den Jungen zu zeigen?
Spinner: Das fängt natürlich mit der Politik an, da sitzen ja die Älteren. Wir befinden uns in einem Wahljahr, da werden politische Entscheidungen vor allem zugunsten der älteren Wählerschaft getroffen. Dabei muss es jetzt darum gehen, den Kindern zu helfen. Die Nachricht, dass nun zwei Milliarden Euro in ein „Aufholpaket“ gesteckt werden, ist ein großer Witz. Das gesamte Budget für Bildungsaktivitäten in Deutschland liegt bei 150 Milliarden Euro pro Jahr. Da kann man sich ungefähr vorstellen, dass diese zwei Milliarden nichts als ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Es gibt Schulen, die haben 1200 Schüler und eine einzige Sozialpädagogin. Da muss man nachrüsten, um Kinder vor Ort betreuen zu können. Dazu kommen Klassenfahrten oder andere gemeinschaftsfördernde Projekte. All das kostet Geld, und wir Alten müssen es zur Verfügung stellen. Rentengeschenke haben die vergangenen Regierungen genug verteilt.
Dötsch: Ich bin sehr davon angetan, dass Sie sich heute so für das Thema einsetzen, Herr Spinner. Die Rückkehr zu einem normalen sozialen Leben muss jetzt möglich gemacht werden. Es darf nicht erst durch Kompensationsleistungen versucht werden, das Ganze im Nachhinein wieder aufzuholen. Was jetzt verloren gegangen ist, ist viel schwerer wieder aufzuholen. Das wissen alle, die eine Zeit lang mal die Schule verpasst haben.
Was können Eltern in der aktuellen Situation tun?
Dötsch: Das beginnt mit dem Impfen. Es ist unsere Pflicht als Erwachsene, dass wir uns selber impfen lassen. Wir können nicht von den Kindern und Jugendlichen erwarten, dass sie die Herdenimmunität absichern. Das ist eine ganz leichte Rechnung: Wir haben 14 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland und eine Bevölkerung von 82 Millionen Menschen. Dieser kleine Teil von 14 Millionen kann die Herdenimmunität nicht sichern. Ein zweiter Punkt ist, dass wir als Erwachsene eine Vorbildfunktion haben. Wenn wir den Kindern und Jugendlichen nicht vorleben, dass wir uns an die geltenden Hygieneregeln halten, wenn wir vielleicht auch noch damit kokettieren, dass wir sie an der ein oder anderen Stelle übertreten, dann geben wir ihnen ein Beispiel, das nicht dazu führt, dass sie sich selbst an die Regeln halten. Also in der Summe: Erwachsene müssen das, was sie von den Kindern erwarten, auch selbst vorleben.
Sind Sie grundsätzlich dafür, dass die zwölf- bis 15-Jährigen geimpft werden?
Dötsch: Ich halte es für unglaublich wichtig, dass den Kindern und Jugendlichen ein Impfangebot gemacht wird. Und wenn nun die Stiko empfiehlt, dass erstmal nur Risikopatienten geimpft werden und den anderen die Entscheidung freigestellt wird, dann ist es auch hier wichtig, dass die Familien mit einem sicheren Gefühl an die Sache herangehen können. Dass sie sich etwa mit ihren Jugendlichen beim Arzt gemeinsam informieren, um dann eine individuell basierte Entscheidung zu treffen, ob eine Impfung sinnvoll ist oder nicht. Und ich möchte betonen: „Angebot“ ist das Motto der Stunde und nicht, dass Kinder geimpft werden müssen, weil sie sonst nicht mehr in die Schule dürfen. Schulöffnungen dürfen nicht von der Durchimpfungsrate bei den Kindern und Jugendlichen abhängig sein. Schließlich gibt es auch Kinder unter zwölf Jahren. Bei ihnen wird es noch lange dauern, bis entsprechende Studien vorgelegt werden, die EMA den Impfstoff zulassen kann und die Stiko eine Empfehlung ausspricht.
Das könnte Sie auch interessieren:
Wieso kann man das Impfen von Kindern und Jugendlichen nicht so klar empfehlen wie das Impfen von Erwachsenen?
Dötsch: Bei ihnen muss ein Eigennutz bestehen. Das bedeutet, dass es nachweisbar sein muss, dass für jedes Kind individuell mehr Nutzen durch einen Impfung entsteht als potentielle Nachteile. Zum Glück ist es so, dass die Kinder von den gesundheitlichen körperlichen Folgen der Pandemie weniger stark betroffen sind als Erwachsene. Aber deswegen ist es hier sehr viel schwerer nachzuweisen, ob die Impfung im individuellen Fall einen Vor- oder Nachteil hat.
Man merkt im privaten Umfeld mittlerweile, dass Leute durch den Wegfall der Impfpriorisierung am 7. Juni langsam unruhig werden…
Spinner: Klar, sie hat natürlich auch für eine enorme Verschleppung gesorgt. Ich bin 72 Jahr alt und gehöre deswegen der zweiten Prio-Gruppe an. Ich bin nur deshalb früher drangekommen, weil ich fünf Beipässe habe und eine schwere Lungenkrankheit hatte. Solche Krankheiten wünsche ich natürlich niemandem, damit er früher geimpft wird. Aber die Priorisierung hat dennoch allen Jungen das Signal gegeben, dass es für sie noch lange keinen Impfstoff geben wird. Die Aufhebung der Impfpriorisierung ist in meinen Augen daher der richtige Schritt.
EMA und Stiko empfehlen den Impfstoff des Herstellers Astrazeneca für Personen ab 60 Jahren. Doch viele ältere Menschen lehnen ihn weiterhin ab und wollen lieber einen mRNA-Impfstoff wie den von Biontech, obwohl der eigentlich für die Jüngeren vorgesehen wäre. Ein unsolidarischer Akt?
Spinner: Absolut, und einer, der mich sehr wütend macht. Astrazeneca ist ein zugelassener, effektiver und sicherer Impfstoff für Ältere. Man weiß, dass er bei den Jüngeren Nebenwirkungen hervorrufen kann, auch wenn es sich hierbei um minimale Prozentsätze dreht. Wer über 60 Jahre alt ist und diesen Impfstoff ablehnt, hätte ans Ender der Schlange zurückgehen müssen.
Als Grund für die Tatsache, dass Personen aus der ersten und zweiten Prio-Gruppe bisher hauptsächlich mit Biontech und Moderna geimpft wurden, hat das Gesundheitsamt die Liefersicherheit genannt, die bei Astrazeneca nicht gegeben war. Sind in der Politik also die Interessen der jüngeren Generation nicht berücksichtigt worden, als es um die Impfstoff-Verteilung ging?
Spinner: Das ist genau der Punkt, die Interessen der Jüngeren traten auch bei der Impfkampagne in den Hintergrund. Und ich möchte mal grundsätzlich eine Sache ansprechen: Meine Tochter ist Lehrerin an einem Gymnasium hier in Köln und sie erzählt mir immer wieder, wie unglaublich stolz sie auf das ist, was die Kinder und Jugendlichen in der letzten Zeit geleistet haben. Sie haben nicht nur zu Hause rumgesessen, sondern hatten Online-Unterricht, mussten jede Menge soziale Beschränkungen erleiden und sich in dieser neuen Situation zurechtfinden. Natürlich sind im Schulstoff Lücken geblieben – bei einigen mehr, bei anderen weniger. Aber die soziale Entwicklung der Kinder, die mindestens genauso wichtig ist, tritt mir in der Diskussion rund um die Schulöffnungen zu sehr in den Hintergrund.
Herr Dötsch, ist schon abzusehen, welche Langzeitfolgen die Pandemie für Kinder und Jugendliche haben wird?
Dötsch: Das ist natürlich eine unserer großen Sorgen. Deswegen ist unsere klare Forderung, dass das soziale Leben möglichst schnell wieder hergestellt werden soll. Kinder und Jugendliche machen bestimmte Entwicklungsphasen durch und die folgen deutlich schneller aufeinander als es bei Erwachsenen der Fall ist. Wenn diese Entwicklungsphasen nicht angemessen begleitet werden, dann hat das manchmal Folgen bis ins späte Erwachsenenleben. Das ist also etwas, was wir auf jeden Fall im Blick behalten müssen. Ein anderer Punkt sind die körperlichen Folgen bei einer Covid-Erkrankung, da kennen wir bislang auch nur Ansatzpunkte. Wir wissen, dass es diese zweite Erkrankung gibt, das sogenannte PIMS-Syndrom, das dann wenige Wochen später erfolgt. Im Moment versuchen wir auch möglichst viele Daten zu sammeln zu der Frage, ob es auch Long-Covid bei Kindern und Jugendlichen gibt, und wenn ja, wie das aussieht. Es wird noch viele Monate, ich fürchte sogar Jahre dauern, bis wir ganz genau wissen, was die Folgen der Pandemie bei Kindern und Jugendlichen sind. Deswegen muss diese soziale Ausgrenzung, die Herr Spinner so klar beschreibt, aufhören. Wir sind viel stärker in der Verantwortung, Kindern und Jugendlichen ein normales Leben zu garantieren, als es bei Erwachsenen der Fall ist
Sport im Freien ist auch jetzt in der Sommerzeit nur sehr eingeschränkt möglich. Woran liegt es, dass das in der Debatte zu kurz kommt?
Dötsch: Wir haben relativ wenige Experten für Kinder und Jugendliche in den Expertengremien auf Bundes- und Landesebene, die am Schluss die Entscheidungen treffen. Sie werden zwar manchmal gehört, oftmals werden ihre Positionen bei den Entscheidungen nicht berücksichtigt. Deswegen ist die wesentliche Botschaft, die wir jetzt senden müssen, dass für zukünftige Phasen dieser Pandemie oder einer folgenden Pandemie viel klarer sein muss, dass nicht nur spezifische Expertise im Hinblick auf Virusausbreitungen berücksichtigt wird, sondern bis zum Ende gedacht wird. Dass auch die sozialen und gesundheitlichen Folgen beispielsweise eines Lockdowns für Kinder und Jugendliche als uns anvertraute Schutzbefohlene vollumfänglich berücksichtigt werden. Das ist etwas, was wir lernen müssen.
Spinner: Ein Beispiel: In der aktuellen Debatte wird oft nur die Frage gestellt, was nun mit den Schulen gemacht wird. Aber das Wohlergehen der Kinder ist mehr als nur Schule. Kinder und Jugendliche werden zu oft nur in ihrer Funktion als Schülerinnen und Schüler gesehen. Die soziale Unterstützung, die jetzt notwendig ist, ist aber mindestens so wichtig wie der Schulstoff. Das scheint in der Politik offensichtlich noch nicht angekommen zu sein.
Braucht es also eine stärkere gesellschaftliche Debatte, die sich um die Kinderinteressen jenseits der Schule dreht?
Spinner: Genau, auf allen Ebenen, nicht nur in Talkshows oder zwischen Politikerinnen und Politikern. Eigentlich bräuchte Herr Prof. Dötsch im „Kölner Stadt-Anzeiger“ eine wöchentliche Kolumne, vielleicht im Wechsel mit einer Lehrerin, damit diese Themen in den nächsten Monaten fachkundig erklärt werden und in der Politik wirklich präsent bleiben. Ich habe die große Sorge, dass bald wieder business-as-usual einkehrt.
Gibt es auch etwas positives, was die Kinder und Jugendlichen aus der Pandemie mitnehmen?
Dötsch: Ja, jede Krise hat auch immer einen positiven Aspekt. Ich glaube, dass sie viele Familien enger zusammengebracht hat. Dass sie vielleicht auch Diskussionen zu Werten angestoßen hat. Vielleicht wächst nun eine Generation heran, vor allem bei den Jugendlichen, die stärker darüber nachdenkt, was es bedeutet, für andere einzustehen und auch Nachteile in Kauf zu nehmen. Gleichzeitig ist das Problem aber, dass es neben diesen positiven Aspekten zahlreiche negative Effekte gibt, die leider überwiegen. Es gibt Familien, in denen das alles nicht möglich ist. Wir müssen auch an diejenigen denken, für die wir in Jahrzehnten so viel investiert haben, um sie an die Mitte der Gesellschaft heranzuführen. Durch die Pandemie entfernen sie sich davon wieder.
Die finanziellen Folgen, die Schulden, werden wohl eher die Jüngeren zu spüren bekommen. Wie kann eine kluge Politik aussehen, die junge Menschen nach der Krise entlastet?
Dötsch: Die Pandemie hat gezeigt, dass das, was vor der Pandemie gesagt wurde, dass wir an jeder Stelle sparen müssen, auch aufgehoben werden kann, wenn es wirklich ernst wird. Wir müssen Prioritäten setzen. Und wenn die Priorität darin besteht, einer Generation von jungen Menschen, die durch die Pandemie auch einen Teil ihrer Jugend verloren hat, jetzt zu ermöglichen, den Anschluss wiederzugewinnen und sich positiv zu entwickeln, dann darf hier Geld keine Rolle spielen. Denn nur so kann sich auch unser Land weiter gut entwickeln.
Spinner: Sehe ich aus wirtschaftlicher Perspektive ganz genauso. Der deutsche Staat kann sich langfristig zu Nullzinsen verschulden, es ist jetzt die Zeit für Investitionen, insbesondere in unsere jüngere Generation. Solche Investitionen bringen auch hohe wirtschaftliche Renditen mit sich, und dadurch entlasten sie die zukünftige Generation, selbst wenn sie schuldenfinanziert sind. Wer nach dieser Pandemie an der jungen Generation sparen will, hat nichts begriffen.



