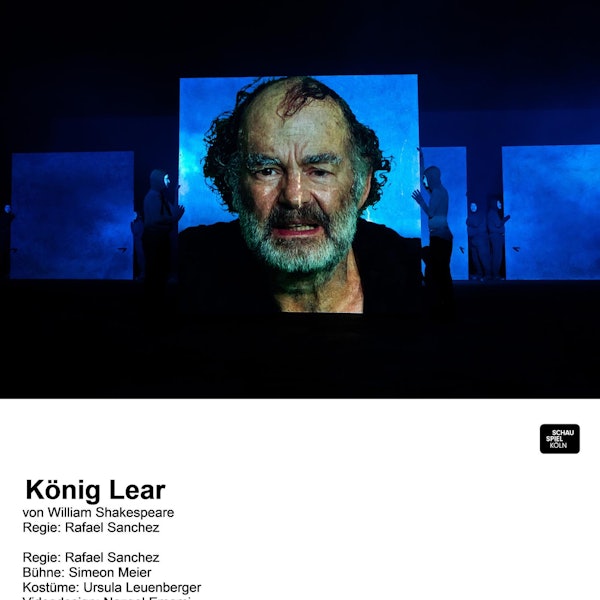Premiere am SchauspielIst Köln nur die stinkende Steigerung von Darmstadt?

Szene aus „Der eingebildete Kranke“
Copyright: Thomas Aurin
Köln – Hypochonder, sagt die Enzyklopädie, das sind Menschen, die zuvörderst unter übertriebener Selbstbeobachtung leiden. Beständig in sich hineinhorchen und am Ende nur noch die Rückkoppelungen dieser Auslotungen der eigenen Befindlichkeit wahrnehmen, anstatt mit der Außenwelt zu interagieren.
Für Molière bedeutete sein letztes Stück „Der eingebildete Kranke“ wohl auch eine Auseinandersetzung mit dem Tod. In der Komödie siegt das Gelächter zumindest über die Angst vorm unweigerlichen Ableben. Das hat sich der Knochenmann nicht lange bieten lassen: Molière, der selbst die Titelrolle spielte, erlitt während der vierten Aufführung einen Blutsturz und starb noch im Kostüm.
Der Tod hat auch in Stefan Bachmanns Inszenierung des Klassikers einen Platz. Aber er sitzt im Stuhlkreis – der stellt bis auf eine Chaiselongue in der Mitte schon das ganze Bühnenbild im Depot 2 dar – ganz außen, kommentiert teufelsgeigend das Geschehen, hält sich aber ansonsten höflich zurück.
Das Lachen wird tabuisiert
Das Gelächter hat hier von Anfang an gewonnen, im kleinen Programmheft hält Dramaturg Thomas Jonigk ein „Plädoyer für das Lachen“: Das werde heute oft „tabuisiert bzw. verboten, pauschal als aggressiv, negativ, (re-)traumatisierend abgewertet oder als Überlegenheitsgestus Privilegierter diskreditiert“. Mit anderen Worten: Heutzutage darf man ja nichts mehr sagen.
In diesem Sinne spielt bei Bachmann zwar die wunderbare, vom Düsseldorfer Ensemble ausgeliehene Rosa Enskat den eingebildeten Kranken Argan, die Beschreibung trifft jedoch auf alle handelnden Personen zu. Lächerliche Figuren, die viel zu sehr mit ihrer Selbst-Viktimisierung beschäftigt sind, als das sie jenseits von Mikro-Aggressionen miteinander in sinnvollen Austausch treten könnten.
Achtsamkeits- und Grenzüberschreitungs-Gefloskel
Der Kölner Intendant hat das Stück vom Autorenpaar Barbara Sommer und Plinio Bachmann überschreiben lassen. Die haben das Grundgerüst der Komödie stehen lassen, daran aber das gesammelte Achtsamkeits- und Grenzüberschreitungs-Gefloskel unserer Zeit gehängt. Die krankhaften Selbstbeobachter werfen sich gegenseitig Empathielosigkeit, manipulatives Sprechen oder mangelnde Distanz vor, halten Reden gegen die große Pharmaverschwörung, oder verlieren sich im Labyrinth politischer Korrekturen und neu geschaffener Gender-Pronomen, „die gerade von einer Gruppe aus Braunschweig ausprobiert werden“.
Die Aussage könnte kaum deutlicher sein, und falls es noch Zweifel gibt, werden die im Programmheft beseitigt: Wir sind die Überempfindlichen, die Kommentarspaltenfüller, die sich in ihren eingebildeten Verletzungen zurückgezogen und rhetorisch radikalisiert haben. Vielleicht bringt ja das gemeinsame Gelächter die verhärteten Positionen zum Schmelzen?
Schießbudenfiguren wie im Louis-de-Funès-Film
Lustig sind die gut anderthalb Stunden allemal. Die Spielenden verwandeln sich mit einer Wonne in groteske Schießbudenfiguren, wie man sie sonst höchstens in alten Louis-de-Funès-Filmen sieht.
Paul Basonga jammert steinerweichend als Drag-Baby-Version der Tochter Angélique, Lola Klamroth gibt deren pronominal herausgeforderten Verehrer Cléante mit – äußerst virtuosen – Tourette-artigen Zuckungen, Kei Muramotos geldgierige Stiefmutter ist eine Stummfilm-Diva wie aus einer Herbert-Fritsch-Inszenierung, Kais Setti verbreitet als Bruder des Kranken mit verbindlichem Grinsen die haarsträubendsten Verschwörungsmythen und Justus Maier und Anja Laïs – nach neun Jahren zurück im Kölner Ensemble, wie schön! – verwickeln sich als quacksalberndes Vater-und-Sohn-Paar kunstvoll in gedrechseltem Gewäsch.
Das könnte Sie auch interessieren:
Nur Melanie Kretschmann spricht als handfeste Dienerin Toinette auch mal Klartext und einzig Rosa Enskat darf wirklich leiden. Krank ist sie zwar nicht, aber wenigstens ihre Schmerzen sind echt. Und spektakulär (eklig) fällt ihre große Köln-Suada aus: „Es kann überhaupt kein Zufall sein“, klagt die Klistier-Geplagte, „dass diese Stadt nach meinem Grimmdarm benannt ist: Kolon, Colonia, Köln. Diese andauernde anale Kolon-Kolonisation ist nirgends so zu Hause wie in dieser Stadt Köln, die nicht Colonia sondern in ungeschöntem Deutsch Grimmdarmstadt heißen müsste, die stinkende Steigerung von Darmstadt – Schwesternstädte im Kot.“ Hihi.
Ja, Lachen befreit. Aber es macht auch gleich, was nicht zusammengehört. Will Bachmann die zugegeben oft verstiegenen Bemühungen um eine geschlechtergerechte Sprache mit rechtem Getrolle gleichsetzen? Nebenbei hat er das Stück selbst genderfluid besetzt. Und glaubt er wirklich, dass, würden wir uns nur alle hart machen gegen die Verlockungen der Nabelschau, die Mitte wieder halten würde?
Tabus rennt er hier jedenfalls keine ein, im Gegenteil, der Abend wählt den Weg des geringsten Widerstands, er lädt ein zum hämischen „Höhöhö“ des angeblich gesunden Menschenverstandes.