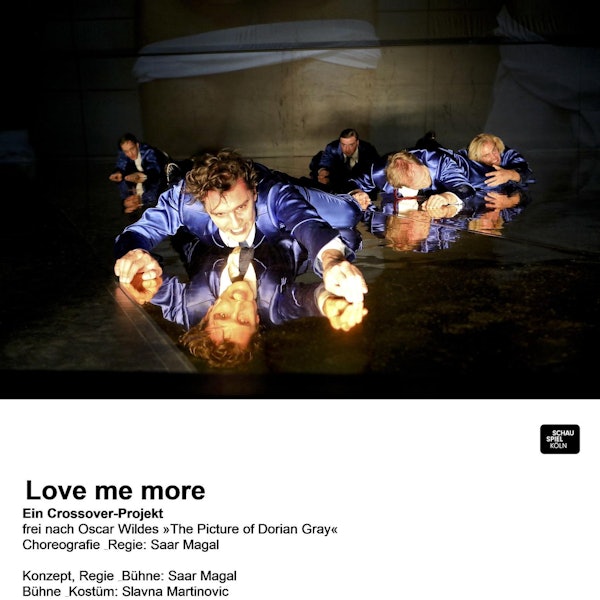Deutscher BuchpreisDie Rasur war spektakulär, aber wie ist Kim de l'Horizons Roman?

Kim de l'Horizon rasiert sich im Frankfurter Römer die Haare ab.
Copyright: dpa
Frankfurt – „Dieser Preis ist nicht nur für mich“, verkündet Kim de l’Horizon im Kaisersaal des Frankfurter Römers. Unterm dichten Schnauzbart lächeln rot geschminkte Lippen.
Dann schaltet die erste nicht-binäre Person, die den mit 25 000 Euro dotierten Deutschen Buchpreis gewonnen hat, den Hairclipper an, den sie zuvor aus einem dunkelgrün irisierenden Paillettentäschchen gekramt hat und entledigt sich ihrer dunkelbraunen Locken. In Solidarität, sagt de l’Horizon, mit den Frauen im Iran.
Im Kaisersaal hört man eine Zeit lang nur das Wespenbrummen des Rasierers. Dann erhebt sich das Publikum applaudierend, auch das eine Buchpreis-Premiere.
Diese Radikalrasur wird Kim de l’Horizon wohl auf alle Ewigkeit Vergleiche mit Rainald Goetz einbringen, dem einstigen Enfant terrible der deutschsprachigen Literatur. Der hatte sich bekanntlich fast 40 Jahre zuvor während seines Vortrags auf dem Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb mit einer Rasierklinge die Stirn aufgeschlitzt und das eigene Blut aufs Manuskript tropfen lassen.
Unmögliche Sprachen für unvergleichliche Erfahrungen
Sollen sie ruhig vergleichen. Mit dem nun ausgezeichneten Romandebüt „Blutbuch“, erschienen im Kölner DuMont Buchverlag, hat de l’ Horizon schon jetzt tiefe Wurzeln geschlagen, hat nicht eine, sondern viele mögliche und unmögliche Sprachen für die Erfahrung gefunden, keinem fixen Geschlecht anzugehören.
Und zugleich den Roman der Frauen seiner Familie geschrieben, deren er/sie gebärmutterlos, von Männern angezogen und vor allem ohne Kinderwunsch die Letzte sei. „Blutbuch“ erzählt, wie eigentlich jeder Debütroman, von der Selbstfindung seines Autors, aber de l’Horizon verfolgt auf der Suche nach der eigenen Geschichte vor allem die matriarchalen Verästelungen seines Stammbaumes und in diesem Sinne ist es ein zutiefst feministisches Werk und die kamerafreundliche Solidaritätsgeste mit den aufbegehrenden iranischen Frauen doch mehr als nur eitle Schau.
Zum Buch
Kim de l’Horizons mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneter Debütroman „Blutbuch“ ist im DuMont Buchverlag erschienen, 336 Seiten, 24 Euro. E-Book 19,99 Euro.
Die äußere Handlung des „Blutbuch“ ist karg und rasch erzählt: Die Reise beginnt mit der Demenzerkrankung der Großmutter, hier nur die Großmeer genannt – wir befinden uns im Berner Umland, in dem de l’Horizon groß geworden ist. Für die Erzählfigur setzt damit der Countdown zur Recherche aller offenen Fragen ein: Was war mit der früh verstorbenen älteren Schwester, deren Namen die Großmeer trägt? Was mit der anderen Schwester, die in die „Weiberarbeitsanstalt Bern“ gesteckt wurde und deren Namen nun die eigene Mutter, die Meer, trägt? Und warum ist sie so kalt und verbittert, die Mutter?
„Als Frau drohte einem, ein Gegenstand zu bleiben oder ein Ozean zu werden“, schreibt Kim de l’Horizon. Aber muss man deswegen gleich zum ganzen Kerl werden? Zwischen diesen vereisten Polen durchmisst de l’Horizon ein Fluidum, das den Roman auch stilistisch prägt: Seine/ihre Sprache kennt keine Grenzen, mäandert vom Autobiografischen zum Essayistischen, von der Zauberformel bis zum Telefongespräch, oder zum nie abgeschickten Brief im nüchtern-unbeholfenem Englisch.
Der Leser wird zur Flipperkugel
Abgehakte Erinnerungsfetzen werden von zu vielen Satzzeichen eingehegt, dann reißt ein gleitendes Parlando den Leser mit, bis er wiederum an harschen, beinahe gewalttätigen Sexszenen abprallt, in denen sämtliche Körpersäfte in Großbuchstaben fließen und als erschöpfte, aber glücklich erschöpfte Flipperkugel in einer Art Proseminararbeit zur Genealogie der Blutbuche zur Ruhe kommt.
Denn das schweizerdeutsche „Buch“ kann den Baum, das Druckwerk, aber auch den Bauch bedeuten, in dem, an Stelle eines Embryos, das Blut der Generationen schwappt: „Im Bauch der Sprache wird alles verdaut und mensch muss, wenn mensch Füße benutzen will, Hände haben, die nicht Ich heißen.“
De l’Horizon leistet sich hierzu auch einige launige Fußnoten, deren längste sich an Übervätern wie Goethe und David Foster Wallace (den König der belletristisch eingesetzten Fußnote) abarbeitet – und auch am ödipalen Konzept des Übervaters an sich. An dessen Stelle schlägt der Autor, der eine Autorin ist, eine neue, weibliche Genealogie der Erzählungen vor, denn aus Schriftstellern mit „Anti-Daddy-Haltung“ würden stets nur die nächsten „Oberüberpapis“.
Warum Literatur immer mit Schuld verbunden ist
Die frühesten Formen der Schrift, heißt es an anderer Stelle, waren Schuldenverzeichnisse, deswegen seien Literatur und Schuld untrennbar miteinander verbunden. Das „Blutbuch“ stürmt auf seinen gut 300 Seiten sprachmächtig gegen dieses Erbe aus Schuld und Scham an, mit Hilfe von Meer und Großmeer, Bourdieu und Butler, Deleuze und Guattari, Harry Styles und RuPaul.
Ist Pop-Literatur und Familiengeschichte, Bildungs- und Heimatroman und zugleich Experiment, manchmal anmaßend, viel häufiger herzerwärmend und immer schonungslos gegen sich selbst und das eigene Milieu. „Blutbuch“ ist ein so würdiger wie aufregender Gewinner des Deutschen Buchpreises, eine mutige Entscheidung der Jury. „Ein neues Sternbild für alte Muster und erstarrte Positionen“, lobt sie in ihrer Begründung.
Das könnte Sie auch interessieren:
Noch bevor Kim de l’Horizon im Römer den Schädel freilegt, sticht seine/ihre Dankesrede bereits heraus. Sie ist nämlich gesungen: „Da ist etwas in dir/Es ist schwer zu erklären“, gibt de L’Horizon a capella auf Englisch zum Besten. Das Stück des französischen House-DJs Kavinsky kennt man noch aus dem Soundtrack des Ryan-Gosling-Filmes „Drive“: „Sie reden über dich, Junge/Aber du bist immer noch derselbe.“