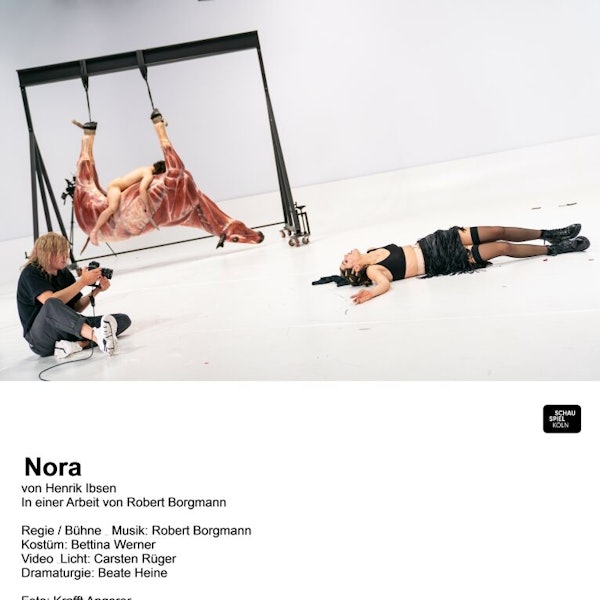Im Gürzenich-KonzertWarum das Metronom in Köln zum Hauptakteur wird

Ein Metronom fixiert die Geschwindigkeit in der Musik.
Copyright: picture alliance / dpa
- 65 Pakete mit Metronomen sind in letzter Zeit in der Philharmonie eingetroffen. Das hat Gürzenich-Pressesprecher Friso van Daalen verraten.
- Sie werden aus folgendem Grund gebraucht: In den fünf Gürzenich-Abokonzerten am 8., 9. und 10. November führt das Orchester György Ligetis „Poème Symphonique“ auf, dessen „Akteure“ exakt hundert Metronome sind.
- Was es mit dem Stück auf sich hat, wie es in Köln aussehen wird und wo das Metronom überhaupt herkommt, lesen Sie hier.
Köln – Es läuft offensichtlich gut an mit den Metronomen: 65 Pakete sind, wie Gürzenich-Pressesprecher Friso van Daalen mitteilt, bereits in der Philharmonie eingetroffen: „Da sind alle nur denkbaren Modelle dabei – groß und klein, aus Holz und aus Plastik. Aber einige wiederholen sich auch.“ Alt und Jung hat geschickt, teils mit Postkarten, die Geschichten über den tickenden Tempogeber erzählen: „Es sieht mittlerweile bei uns aus wie ein Gabentisch.“
Der Hintergrund: In den fünf Gürzenich-Abokonzerten am 8., 9. und 10. November führt das Orchester György Ligetis „Poème Symphonique“ auf, dessen „Akteure“ exakt hundert Metronome sind. Weshalb das Orchester einen Aufruf an die Kölner Bürger gestartet hat, ihm – so vorhanden – mechanische Metronome auszuleihen. Deadline ist der 30. Oktober (wohl mit einigen „Puffertagen“), danach beginnen die Proben.
Unvorhersehbare Knoten und Verdickungen
Was hat es mit diesem „Poème Symphonique“ auf sich? Auf die Idee mit den Metronomen war der damals in Wien wohnende Ligeti 1962 gekommen. Alle sollten sie von Hand aufgezogen und gestartet werden, dann aber in unterschiedlichen Tempi ticken. Das Ergebnis ist ein sich kontinuierlich ausdünnendes, dabei immer wieder neue, unvorhersehbare Knoten und Verdickungen bildendes Netz aus Linien und Punkten.
Welches Konzept aber steckt hinter dieser „Komposition“? Die Frage ist auch deshalb nicht ganz einfach zu beantworten, weil Ligetis Selbstinterpretation, bezogen auf dieses Werk, sich mit der Zeit verändert hat. In der ursprünglichen Version, die 1963 im Rathaus von Hilversum uraufgeführt wurde, ging es sogar noch vergleichsweise „menschlich“ zu: Zehn in Fräcke gesteckte Interpreten setzten auf der Bühne besagte Metronome in Gang, zogen sich dann aber zurück, um erst nach dem Stillstand des letzten Metronoms (virtuell nach bis zu hundert Minuten) wieder zu erscheinen und den Schlussapplaus entgegenzunehmen.
Design erregte Skandal
Dieses szenische Design wurde damals als spöttische Karikatur auf ein bürgerliches Symphoniekonzert (an das ja bereits das „symphonique“ im Titel gemahnt) samt seiner weihevollen Feststimmung gedeutet und erregte in diesem Sinne auch den vorhersehbaren Skandal. Der Komponist selbst indes deutete drei Jahre später die ins Absurde getriebene Aleatorik und Schicht-Kombination sowie die totale Mechanisierung der Aufführung als Kritik an seinerzeit verbreiteten kompositorischen Zwangsideologien.
In der später von ihm revidierten Fassung mit einer Höchstdauer von 20 Minuten werden die Metronome bereits vor Einlass des Publikums in Betrieb genommen, treten Frackmänner nicht in Erscheinung. Die kritische Intention entfiel mithin. 1988 bezeichnete der Komponist sein Werk als „überhaupt erstes minimalistisches Stück“ in musikgeschichtlicher Parallele zur gleichzeitig in den USA entwickelten Minimal Music Steve Reichs und Terry Rileys.
Darbietung in Köln unterscheidet sich
Die Kölner Version jetzt wird, so viel verrät van Daalen, von beiden Fassungen abweichen – die Darbietung wird auch weder 100 noch 20, sondern lediglich acht Minuten dauern. Auf jeden Fall hat die bevorstehende Aufführung einen sehr konkreten Orts- und Zeitbezug: Der Ortsbezug besteht darin, dass Ligeti in den Jahren 1957 und 1958, damals gerade aus dem kommunistischen Ungarn geflüchtet, ausgerechnet in Köln Aufnahme fand, an Karlheinz Stockhausens Seite im WDR-Studio für elektronische Musik arbeitete und dabei tief in deren Pionierphase eintauchte.
Infos zur Werk und Aufführung
György Ligeti (1923-2006), österreichischer Komponist ungarischer Herkunft, komponierte sein „Poème symphonique“ für hundert mechanische Metronome 1962 in Wien. Die Uraufführung erfolgte am 13. September 1963 im Rathaus der niederländischen Stadt Hilversum. Der Komponist selbst unterzog das Stück einige Jahre später einer einschneidenden Revision.
Das Werk wird in den Gürzenich-Konzerten des 8., 9. und 10. November aufgeführt. Das Orchester hat Kölner Bürger aufgerufen, Metronome auszuleihen. Zu gewinnen gibt es Freikarten, signierte CD’s und bedruckte Mund- und Nasenschutzmasken. Teilnahmebedingungen unter
www.guerzenich-orchester.de/wietickstdu
Außerdem erklingen eine „Fanfare für Blechbläser“ von Philippe Manoury (eine Auftragskomposition des Gürzenich-Orchesters) sowie Beethovens achte Sinfonie (in der der Klassiker Metronomeffekte musikalisch gestaltet) und sein drittes Klavierkonzert. Solist ist der Südafrikaner Kristian Bezuidenhout. Dirigent ist Gürzenich-Kapellmeister François-Xavier Roth. (MaS)
Der zeitliche Bezug gilt der Tatsache, dass das Gürzenich-Konzert noch im Beethoven-Jahr (250. Geburtstag) stattfindet: Beethoven war der erste prominente Komponist, der sich die Möglichkeiten des soeben erfundenen Metronoms zunutze machte, seine Sinfonien mit Metronomangaben versah und damit die für alle vorangegangenen Musik bedeutsame Frage, wie schnell oder wie langsam denn ein Werk zu spielen sei, tendenziell obsolet machte. Tendenziell, denn besagte Metronomangaben sind bis heute umstritten. Musikalisch verarbeitete er Metronomeffekte in seiner achten Sinfonie, die im Abo-Konzert ebenfalls erklingt (nebst dem dritten Klavierkonzert).
Patent im Jahr 1815
Als Erfinder des neuen mechanischen Geräts zur Tempofixierung oder -messung wird meist der Konstrukteur Johann Nepomuk Mälzel genannt, der sich das Gerät 1815 patentieren ließ (er konkurriert allerdings mit dem Mechaniker Dietrich Nikolaus Winkel). Zumindest stammt der Name von ihm – weshalb die Metronomangabe, genauer: die Angabe der Schlagzahl pro Minute, traditionell mit dem Kürzel „M.M.“ („Mälzels Metronom“) eröffnet wird. Ob der Schlag einem Achtel, einem Viertel, einer Halben oder sonst einer Einheit gilt, muss freilich ebenfalls notiert werden.
Musikgeschichtlich gesehen bezeichnet das Ticken des unerbittlichen Zeitmessers, das so manchen Klavier- und Geigenschüler zur Verzweiflung getrieben haben dürfte, einen fortgeschrittenen Stand jenes Rationalisierungs- und Objektivierungsprozesses, dem das abendländische Musikgeschehen seit seinen Anfängen unterworfen war. An der Entwicklung der Notenschrift von den archaischen Neumen über die Mensuralnotation des Mittelalters bis zur noch immer weithin gebräuchlichen modernen Notation lässt sich dieser Prozess beobachten.
Metronom löst Problem des Grundtempos
Bis zu einer auf der mathematischen Quadratur beruhenden Notation, wie sie uns heute selbstverständlich erscheint (zwei Sechzehntel ergeben ein Achtel, zwei Achtel eine Viertel, zwei Viertel eine Halbe, zwei Halbe eine ganze Note), war jedenfalls ein weiter Weg zurückzulegen. Dabei besagt diese Notation nur etwas über die Dauerrelation zwischen einzelnen Noten (oder Tönen), nichts aber über das Grundtempo, also die Geschwindigkeit, in welcher sie aufeinanderfolgen. Dieses Problem wurde, wie gesagt, erst durch das Metronom gelöst.
Wie ordnet sich Ligetis „Poème Symphonique“ in den beschriebenen Prozess ein? Vorderhand ist hier eine mechanische Revolution am Werk: Der Mensch, das per definitionem Nicht-Mechanische bei aller Musikausübung, dankt zugunsten jener „Maschinen“ ab, die ursprünglich nur Hilfsmittel waren. Womit der definitive Zielpunkt der Rationalisierung erreicht ist – die von Heidegger und anderen düster beschworenen Herrschaft der „Technik“. In der Tat könnte man von einer Klang – besser: Geräusch – gewordenen Dystopie sprechen.
Zeitliche Symbolik
So einfach aber ist es nicht. Eine hintergründige Dialektik nämlich lässt aus der vollendeten Maschinisierung wieder ein Humanes herausspringen – jedenfalls vermittelt das „Stück“ diese Anmutung. So oder so ist es wohl nicht ganz abwegig, in den tickenden hundert Metronomen Platzhalter lebendiger Wesen zu sehen. Das gleichmäßige Ticken – das nur deshalb chaotisch wirkt, weil eben alle Geräte simultan in unterschiedlichen Geschwindigkeiten ticken – signalisiert jenes unbarmherzig-messende Voranschreiten von Zeit, wie es auch der menschliche Herzschlag tut.
Große Kompositionen des Kanons wie die Pamina-Arie in der „Zauberflöte“ („Ach, ich fühl’s, es ist entschwunden“) oder Richard Strauss’ Sinfonische Dichtung „Tod und Verklärung“ imitieren genau diesen Herzschlag – der bei Strauss schließlich stockt, weil ein Leben an sein Ende kommt. Vergleichbares geschieht mit einem Metronom, das „austickt“, weil es nicht mehr aufgezogen wird, keine Vitalitätsimpulse mehr empfängt. Solchermaßen wird das Gerät zur Allegorie von vergehender Zeit, Vergänglichkeit, Tod. Manche Metronome ticken bei Ligeti schneller aus als andere, „Leben“ sind unterschiedlich lang. Es werden aber immer weniger – eine „Abschiedssinfonie“ à la Ligeti.
Das könnte Sie auch interessieren:
Das Stück „heißt“ dies alles nicht in einem handfesten Sinn, aber solche Bedeutungen schwingen vielsagend-verschwiegen mit. So sprengt dieses „Poème Symphonique“ den Rahmen einer amüsanten Groteske.