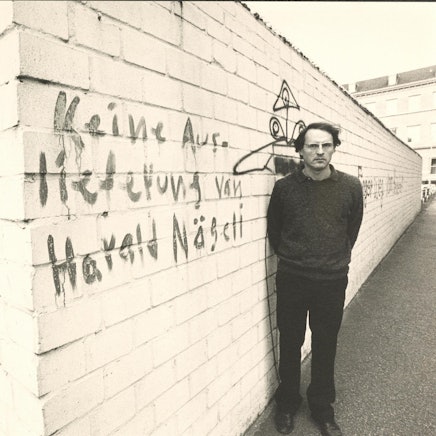Hermann Nitsch ist gestorbenEin Künstler zwischen Blutfontänen und Kreuzigung

Hermann Nitsch (1838-2022)
Copyright: dpa
Köln – Es ist kein Geheimnis, dass sich weite und nicht die schlechtesten Teile der modernen Kunst als Religionsersatz begreifen. Manchmal ging das eher ins Protestantisch-Strenge wie auf den Kachelbildern Piet Mondrians und manchmal waberte es ins Katholisch-Überschwängliche hinein wie beim österreichischen „Skandalkünstler“ Hermann Nitsch. Dessen „Orgien-Mysterien-Theater“ wurde gerne mit einer schwarzen Messe verglichen, doch waren die auf offener Bühne gekreuzigten Opferlämmer und all die Blutfontänen im Grunde so christlich wie die Eucharistie. Oder jedenfalls fein austariert zwischen Heidnischem und Heiligem.
Für Skandale reichten die Spektakel von Hermann Nitsch jederzeit
Für Skandale reichten die Passionsspektakel selbstredend jederzeit, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. In den 1960er Jahren wurde Nitsch vor allem von katholischen Würdenträger verdammt, die in seinen volkstümlich-blutigen Mysterienspielen jene Gotteslästerung witterten, die ja tatsächlich in seiner kunstreligiösen Anmaßung lag. Später kamen die Tierschützer hinzu, die es verständlicherweise nicht gerne sahen, dass jemand Tiere schlachtete, um es Kunst zu nennen. Und intellektuellen Feingeistern war der rauschebärtige Nitsch mit seinen blutgetränkten Nackten sowieso zu derb und roh. Auch da muss man nicht widersprechen: Selbst aus der YouTube-Konserve kommt einem leicht der Ekel, wenn es bei Nitsch „orgiastisch“ wird.
Trotzdem wurden die Polizeieinsätze mit den Jahren seltener, und irgendwann mochte sich kaum noch jemand darüber aufregen, dass Nitsch auf die Documenta eingeladen wurde oder entschärfte Versionen des „Orgien-Mysterien-Theaters“ auf deutsche Opernbühnen brachte. Im Gegenteil: Heute bestreitet kaum noch jemand, dass Nitsch eine modernisierte Form von Richard Wagners Weihefestspielen im Sinn hatte, als er seine Gesamtkunstwerke aus Malerei, Musik, Theater, Liturgie und Ritualen mit den Lehren von Antonin Artaud und Marquis de Sade kreuzte. Bei ihm sollten Ekel und Abscheu die Menschen befreien.
Das könnte Sie auch interessieren:
Wie bei vielen Fluxus- und Aktionskünstlern stellt sich auch bei Hermann Nitsch die Frage, was von seinen spektakulären Inszenierungen bleibt. Vor Videoleinwänden stellt sich eher keine Katharsis ein, wie beim Gottesdienst fehlt einem der Weihrauch. Allerdings sah sich Nitsch wohl ohnehin als Maler, für den der klassische Bildrahmen zu klein geraten war. Für seine treffend betitelten „Schüttbilder“ schüttete er Farbeimer über Leinwänden aus, eine kunstvolle Vergröberung von Jackson Pollocks Träufel-Bildern, die erstaunlich malerische Ergebnisse erzeugt.
Bei jüngeren Künstlern wie Christoph Schlingensief hat Nitsch Spuren hinterlassen und sein „Orgien-Mysterien-Theater“ ist ein Fortsetzungserfolg – sogar im Wiener Burgtheater, wo im Jahr 2005 die damals 122. Aufführung stattfand. Es war der Abschluss einer langen Heimkehr, nachdem Nitsch von empörten Landsleuten vorübergehend ins deutsche Exil getrieben worden war. Im Grunde lässt sich sein Werk auch als sehr spezielle Ausformung des österreichischen Katholizismus umschreiben mit seinen mystizistischen Anklängen, seiner Volkstheaterhaftigkeit und der Aversion gegen jede Form religiöser und sonstiger Heuchelei. Am Ostermontag ist Hermann Nitsch im Alter von 83 Jahren in Mistelbach bei Wien gestorben.