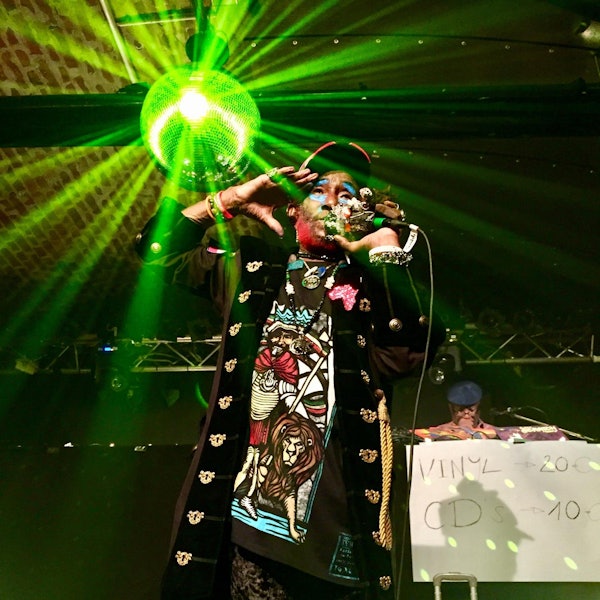Zum Tod von Mikis TheodorakisDer Mann, der den Sirtaki erfand

Mikis Theodorakis
Copyright: Wolfgang Kluge/dpa
Athen – Dieser Komponist war, was den wenigsten Vertretern der musikalischen Moderne oder gar Avantgarde widerfährt: Er war populär. Ja mehr als das: Mikis Theodorakis, der am Donnerstag im gesegneten Alter von 96 Jahren in Athen gestorben ist, war eine Legende.
Das klingt abgedroschen, aber in seinem Fall stimmt das Klischee mit der Wirklichkeit überein. In dieser Legende überkreuzte sich übrigens vieles: Die Aura des Musikers verschmolz mit der des lebensprallen, quasi-antiken „Urgriechen“, des antifaschistischen Widerstandskämpfers, des engagierten Politikers und Parteikommunisten.
Den Sirtaki gab es nicht
Weithin wirksam, verdichtet sie sich in Michael Cacoyannis’ Film „Alexis Sorbas“ von 1964, zu dem Theodorakis den Soundtrack schrieb. Kaum ein Zeitgenosse dürfte, selbst wenn er das Werk nicht im Kino sah, der Melodie des Sirtaki entgangen sein – beim „Griechen um die Ecke“ war und ist sie unweigerlich zu hören. Anthony Quinn in der Titelrolle des anarchischen Vitalisten aus dem verherrlichten „Volk“ tanzt ihn am kretischen Strand mit seinem Partner Basil (Alan Bates).
Diesen Sirtaki gab es übrigens vor Theodorakis nicht – weil Quinn die komplizierten Schrittfolgen griechischer Volkstänze nicht beizubringen waren, erfand er ihn in deren Linie. Das angebliche archaische Urbild von Tanz überhaupt ist ein Fake, wenn man so will, wie die angeblich antike Vase auf einem Trödelmarkt.
In die Beine gefahren
Eine Tradition wurde – ein Widerspruch in sich – von Theodorakis „gemacht“. Zugleich wird in dieser Musik der Grund erkennbar, warum ihr Schöpfer zum berühmtesten griechischen Komponisten im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts werden konnte: Sie ist – im Rhythmus ihrer schlendernden Beschleunigung und der in ihrer schlagenden Simplizität extrem einprägsamen melodischen Folge – suggestiv, fährt jedem, der sie hört, nicht nur in die Ohren, sondern sogleich auch in die Beine.
Es ist übrigens just diese unverstellte körperliche Attacke, dieser sinnliche Appeal, der Theodorakis den Musikvertretern der intellektuellen Hardcore-Avantgarde verdächtig machte. Die in seiner Zeit politisch korrekte Links-Orientierung konnte daran nichts ändern, politischer Widerstand und gleichzeitige ästhetische Anpassung an den Massengeschmack – das war in der Auffassung der Adorno-Adepten eine schwer erträgliche und eigentlich „unmögliche“ Verbindung. Liest man heute avancierte Führer durch die Landschaft der Neuen Musik, dann fehlt dort auch oft genug der Name Theodorakis. Und das, obwohl der während seines Studiums im Paris der 50er Jahre von Olivier Messiaen und René Leibowitz den handwerklichen Ritterschlag erhalten hatte.
Das könnte Sie auch interessieren:
Geboren wurde der 1,90 Meter-Mann 1925 auf der Insel Chios vor der türkischen Küste. Noch als Jugendlicher schloss er sich dem Widerstand gegen die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg an, den er mit Haft und Folter bezahlte. Im anschließenden Bürgerkrieg kämpfte er auf Seiten der Kommunisten, für die er kurz darauf auch im griechischen Parlament saß. Auch als 1967 die Obristen putschten, ging Theodorakis in den Widerstand. Man nahm ihn fest und schob ihn 1970 nach Frankreich ab; seine Lieder wurden verboten.
Indes war Theodorakis, auch wenn er in der DDR Konzerte gab, kein Doktrinär: Nach der Diktatur schloss er sich den Sozialisten an, und Minister wurde er sogar in der Regierung des Konservativen Konstantinos Mitsotakis. Opportunismus? Man wird es im Fall von Theodorakis wohl nicht so sehen können: Der betonte glaubwürdig, er habe stets das getan, „wovon ich glaubte, es sei nützlich für mein Land“ und sei stets „ein Beispiel des guten Kommunisten“ geblieben. In den vergangenen Jahren galt er als Unterstützer der Syriza-Partei von Alexis Tsipras.
Politisches Engagement
Die Vielfalt seiner von politischem Engagement und eben dem Interesse an breitenwirksamer Verständlichkeit getragenen Kompositionen schließt Lieder – weltberühmt geworden durch Melina Mercouri und Maria Farantouri – genauso ein wie Sinfonien, Oratorien, Ballette und Kammermusik, dazu Film- und Theatermusik. Wer – neben „Alexis Sorbas“ – einen möglichst authentischen Theodorakis sucht (was immer das bei diesem genialen Kompilator heißen mag), der findet ihn womöglich in seiner Antiken-Trilogie mit „Medea“, „Elektra“ und „Antigone“ (1991 bis 1999). Traditioneller Opernästhetik verweigert sich diese, die attischen Tragödien werden in melodischen Sprechgesang übersetzt. Die Klangsprache ist tonal, wobei Theodorakis viel mit alten Kirchentonarten arbeitet.
Von Richard Strauss’ moderner „Nervenkontrapunktik“ ist das denkbar weit entfernt, aber in ihrer Bewegungsgestik entfaltet diese Musik unstrittig eine starke Wirkung. Walter Benjamin imaginierte einst, durchaus mit positiver Zielrichtung, eine nach-auratische Massenkunst. Vielleicht hätte er in Mikis Theodorakis den erkannt, der das Erträumte ins Werk setzte.