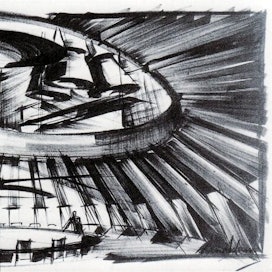Neuer BondWieso Daniel Craig diesmal nicht die Welt, sondern das Kino retten muss

Daniel Craig als James Bond
Copyright: Nicola Dove/Danjaq, LLC/MGM/PA Wire/dpa
London – Lieber würde er sich die Pulsadern aufschlitzen, hatte Daniel Craig nach Drehschluss seines vierten Bond-Films „Spectre“ verkündet, als noch einmal den Agenten zu spielen.
Es war wohl schlicht die Erschöpfung, die damals aus dem Endvierziger sprach. Die Rolle war körperlich viel anspruchsvoller geworden als noch zu Roger Moores Zeiten. Der hatte vor allem das Heben seiner Augenbrauen trainiert.
Danny Boyle wollte Bond sterben lassen
Jedenfalls erklärte sich Craig kurze darauf relativ geräuschlos dazu bereit, für „Keine Zeit zu sterben“ noch ein letztes Mal, in den Smoking zu schlüpfen, die Walther PPK im Anschlag. Dennoch sind nun sechs Jahre seit „Spectre“, der im Oktober 2015 in die Kinos kam, vergangen. Erst sprang mit Danny Boyle der Regisseur ab (Cary Joji Fukunaga übernimmt) – angeblich hatte er ein Drehbuch eingereicht, an dessen Ende Bond sterben sollte – dann kam Covid und der fertige Film musste mehrmals verschoben werden.
Jetzt hängen die Hoffnungen der gesamten Branche am 25. Outing des langlebigsten aller Film-Franchises. Andere potenzielle Blockbuster wie „Tenet“, „Black Widow“ oder „Dune“ wurden (und werden) zeitgleich mit dem Kinostart auf Streamingkanälen ausgewertet.
Amazon kauft MGM
Prompt machte 2020 das Gerücht die Runde, die klamme Filmproduktionsgesellschaft Metro-Goldwyn-Mayer habe „Keine Zeit zu sterben“ den Streamingdiensten Netflix und Apple für 600 Millionen Dollar angeboten. Stattdessen verkündete vergangenen April mit Amazon ein dritter Streamingdienst, MGM für 8,5 Milliarden Dollar aufzukaufen: Die hohe Summe ergibt sich dabei weniger aus dem Wert des Studios als dem seines Filmbestandes, die James-Bond-Reihe miteingeschlossen. Schließlich starb vor einem Jahr mit Sean Connery auch noch der erste und ikonischste Bond-Darsteller.
„Keine Zeit zu sterben“ – der Filmtitel klingt jetzt beinahe trotzig – erscheint also inmitten einer Zeitenwende. Es geht um nichts weniger als die Zukunft des Kinos. Ausgerechnet der Einzelkämpfer Bond soll diesen Ort des kommunalen Erlebens retten.
Sechs Jahren Funkstille zwischen Filmen
Schon einmal waren sechs Jahre zwischen zwei Bonds vergangen, schon einmal markierte die lange Pause eine Zäsur: Als „Lizenz zum Töten“, der 16. Film der Eon-Filmreihe, 1989 an den Kinokassen schwächelten, unken viele das Ende des Agenten herbei. Nicht zuletzt Timothy Dalton. Der vierte offizielle Bond-Darsteller hatte sich bemüht, die Figur zurück zum hartleibigen Zyniker der Ian-Fleming-Romane zu führen.
Daniel Craig sollte dafür 15 Jahre später gefeiert werden. Doch Daltons Bond wirkte plötzlich wie jeder beliebige Actionstar seiner Zeit. Wer brauchte Bond, wenn Bruce Willis’ hemdsärmeliger John McClane den Job ebenso gut erledigen kann? Anschließend spekulierte Dalton öffentlich über das Ende der Serie.
Das könnte Sie auch interessieren:
Vieles sprach dafür: James Bond war der ultimative Held des Kalten Krieges, der war aber nun definitiv vorbei. „Lizenz zum Töten“ sollte auch der letzte Bond-Film von Original-Produzent Albert „Cubby“ Broccoli, seinem langjährigen Drehbuchautoren Richard Maibaum und Cutter und Regisseur John Glen sein. Anschließend verkomplizierte noch ein Gerichtsverfahren um die Rechte an den 007-Filmen die Lage.
Als Bond 1995 in „GoldenEye“ in der Gestalt von Pierce Brosnan wiederauferstand, war er ein anderer geworden. Im Panzer kurvte er kühl und elegant gewandet durchs Posthistoire. Brosnans triumphal gestartetes Update der Figur endete 2002 unrühmlich in der übergagten CGI-Orgie „Stirb an einem anderen Tag“. Die cool verspielten 1990er waren vorbei, für die Post-9/11-Welt fehlte diesem Bond die Schmerzempfindlichkeit.
Mit Knoten gegen Hoden
Daniel Craig musste sich in seinem Einstand mit „Casino Royale“ dann gleich ein verknotetes Seil gegen die Hoden schlagen lassen: Sein Bond fühlt mehr, aber er killt auch so eiskalt wie einst Sean Connery. Vor allem jedoch stellt die Craig-Ära den Versuch dar, einem durch und durch zweidimensionalen Charakter inhaltliche Tiefe zu verleihen.
Ein nahezu unmögliches Unterfangen und es ging auch nicht immer gut: In „Ein Quantum Trost“ verhedderte sich der Spion im wirren Drehbuch und „Spectre“ gelang das Kunststück, Bonds größten Widersacher Blofeld zum Seifenopern-Schurken zu degradieren: Kurzerhand erklärte er sich zu Bonds Stiefbruder und heimlichen Drahtzieher aller tragischen Ereignisse in dessen Leben.
Daniel Craig als amtsmüder Spion
Man will, wie es dank der Neuerfindung des Fernsehens als Hochkultur unbedingt seriell erzählen. Die Figur strebt sich dagegen, dass sieht man sogar im sonst exzellenten „Skyfall“, wo Craig mal den Grünschnabel mal den Amtsmüden geben muss.
„Keine Zeit zu sterben“ setzt diesen Willen zur Kontinuität um jeden Preis fort. Christoph Waltz’ Blofeld taucht erneut auf und zum ersten Mal wird mit Léa Seydouxs Madeleine Swann eine Bond-Gespielin zweitverwertet. Vom schlüpfrigen Pennälerwitz („Pussy Galore“) zur Proust-Anspielung: Auch hier hat sich einiges verändert. Der narrative Ballast lässt die Laufzeit auf 163 Minuten anschwellen, es ist der längste Bond aller Zeiten, eine ganze Stunde länger als „Ein Quantum Trost“.
Wo Ian Fleming Bond erfand
Ob nun alle Erzählstränge zu einem befriedigenden Ende geführt werden können? Am Anfang von „Casino Royale“ erhält Craigs Bond seine Doppelnull-Lizenz, in „Keine Zeit zu sterben“ wird er aus der Frührente zurückgerufen: Die verbringt er in Jamaika, dort wo Ian Fleming sich die Figur vor knapp 70 Jahren ausgedacht hat und wo Connerys Bond sein erstes Abenteuer erlebte, 1962 in „Dr. No“.
Ob es ein Zufall ist, dass Rami Maleks Bösewicht Safin im „Keine Zeit zu sterben“-Trailer eine Nō-Theater-Maske trägt?