Die US-Essayistin Claire Dederer denkt in „Genie oder Monster“ über die Kunst von schlechten Menschen nach. Ohne sich dabei selbst zu schonen.
Neues Buch über monströse KünstlerWarum bald jeder Mensch gecancelt wird

Roman Polański, genialer Regisseur und Vergewaltiger
Copyright: Sebastien Nogier/EPA/dpadpa
„Ich wünschte mir“, schreibt die US-Essayistin Claire Dederer, „jemand würde einen Online-Rechner erfinden, in den der User den Namen eines Künstlers eingeben könnte. Der Rechner würde daraufhin die Schändlichkeit des Verbrechens gegen den künstlerischen Wert des Werkes aufrechnen und schließlich ein Urteil ausspucken: Das Werk dieses Künstlers darf konsumiert werden oder nicht.“ Angesicht der exponentiellen Fortschritte selbstlernender Maschinen erscheint dieser Wunsch noch nicht einmal so absurd, wie in Dederer gemeint haben mag.
Doch selbst wenn es einmal solch einen Cancel-Algorithmus geben sollte, am eigentlichen Problem zielte er vorbei. Das verhält sich ein wenig so, wie mit Douglas Adams fiktivem Supercomputer Deep Thought der nach 7,5 Millionen Jahren Rechenzeit auf die Masterfrage nach „dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“ die Antwort „42“ ausspuckt. Eine objektive Antwort ist unmöglich, entscheiden kann man solche Fragen nur von Mensch zu Mensch.
Weshalb Dederer in ihrem Buch „Genie oder Monster“ mit dem Untertitel „Von der Schwierigkeit, Künstler und Werk zu trennen“ gar nicht erst nach einem moralischen Generalschlüssel sucht, sondern lieber versucht, Schritt für Schritt, Problemstellung für Problemstellung vorzugehen, dabei stets die eigenen Paradoxien und moralischen Untiefen ausleuchtend. Angefangen mit ihrer Liebe zum Werk des Regisseurs Roman Polański. Die lässt sich, wie das im Fall der Liebe nun mal so ist, kaum hinterfragen: „Ich wollte diese Filme sehen, weil sie großartig waren. Das ist alles.“
Warum Woody Allens Film „Manhattan“ leichte Übelkeit verursacht
Und doch bleibt da die Tatsache, dass das Genie hinter „Ekel“ und „Chinatown“ im Jahr 1977 ein 13-jähriges Mädchen unter Drogen gesetzt und anal vergewaltigt hat. Die stört beim Genuss der Filme, verursacht „ein ziemlich unangenehmes Stechen“: „Das Schreckliche“, wie Dederer im nächsten Kapitel schreibt, „stört das großartige Werk.“ Ihr Buch basiert auf dem preisgekrönten Essay „Was machen wir mit der Kunst monströser Männer?“, den sie 2017 in der „Paris Review“ veröffentlicht hat, als Reaktion auf die Enthüllung von Harvey Weinsteins Geschichte sexuellen Missbrauchs und weiterer, darauf folgender MeToo-Fälle.
Das „Wir“ in der Überschrift ihres Essays, urteilt Dederer nun über sich selbst, sei allzu billig, „eine Möglichkeit, gleichzeitig persönliche Verantwortung von sich zu weisen und sich in den Mantel der Autorität zu hüllen“. Ohne „ich“ geht es hier nicht weiter. Etwa, wenn Dederer schildert, dass sie besonders angeekelt auf Woody Allens Beziehung zu seiner Stieftochter reagiert habe („ein persönlicher Affront“), weil sie ein wunderbares, rein väterliches Verhältnis zu ihrem Stiefvater gehabt habe. Und trotzdem lobt sie ein paar Seiten darauf „Der Stadtneurotiker“ als „die beste Filmkomödie des 20. Jahrhunderts“.
Doch Allens darauffolgender Film „Manhattan“, in dem sein 42-jähriger Charakter eine 17-jährige Schülerin datet, verursacht ihr dann wieder „leichte Übelkeit“. Ja, das ist nicht konsequent und schon gar nicht gehorcht es den Regeln des „New Criticism“, die auch dem Rezensenten noch im Studium eingebläut wurden, dass Werk und Autor stets fein säuberlich zu trennen seien (und noch später eröffnet die Autorin, dass ihr „Stadtneurotiker“-Hyperbel nur ein Witz gewesen sei, wer könne schon sagen, was das beste von irgendwas sei?). Die Autor-Werk-Trennung findet nun nicht einmal mehr im akademischen Kontext statt und im öffentlichen Diskurs scheint es derzeit undenkbar. Oder reduziert sich auf kleinkindliche Trotzreaktionen à la „Ich lasse mir doch von Soundso nicht vorschreiben, was ich zu sagen/hören/gucken habe“.
Das Schreckliche stört das großartige Werk.
Im Normalfall müsste jetzt eine Klage über die Idiotie der angeblichen „Cancel Culture“ folgen, über die vor allem Menschen klagen, die das beleidigte „Wird man ja wohl noch sagen dürfen“ zu ihrer Geschäftsgrundlage gemacht haben. Aber auch hier hat Dederer schon um eine Ecke weiter gedacht: „Jeder Mensch mit einer Biografie“, schreibt sie, „ist entweder schon gecancelt oder wird bald gecancelt.“ Was nicht heißen soll, dass sich die gesammelten moralischen Verfehlungen der Menschheit gegenseitig canceln, also aufheben, würden. Sondern, im Gegenteil, dass es keinen Kunstgenuss mehr geben kann, der nicht vom Biografischen eingefärbt ist. Claire Dederer erspart den Lesenden auch nicht den Katalog eigener Verfehlungen, von der Alkoholsucht bis zum Versagen als Erziehungsberechtigte: „Bin ich ein Monster?“, fragt sie: „Wie sich herausgestellt hat, ist die Antwort ein klares Ja.“
Sie nennt diese biografischen Details, von denen man lieber nichts gewusst hätte, den Fleck: „Der Fleck beginnt mit einem Akt, einem Moment, aber dann breitet er sich von diesem Moment aus wie ein Teebeutel, der in heißem Wasser zieht, und färbt das gesamte Leben ein. Er durchdringt Vergangenheit und Zukunft. Dem Prinzip der Rückwirkung folgend bedeutet es, dass man auch vor dem Zeitpunkt, an dem man sich wie ein richtiges Arschloch verhalten hat, schon ein Arschloch war.“
Oder sind diese Details doch das Entscheidende? Ist das Lob der Ignoranz nur Generation-X-typische Nostalgie? Die Sehnsucht nach einer verlorenen Zeit, als das Wissen um die richtigen Bücher, Filme oder Alben noch höchster Geheimhaltungsstufe unterlag und Künstler (und viel seltener Künstlerinnen) die Aura des Unergründlich umwob? Dazwischen hält sie noch ein Plädoyer für einen zweimal verfilmten Roman, an den sich heute wohl niemand mehr herantrauen würde: Vladimir Nabokovs „Lolita“. Der sei so monströs, weil er einen gewöhnlichen Pädophilen beschreibe, der eine außergewöhnliche, oder zumindest doch eigenständige Persönlichkeit zerstöre. Wer ihn liest, soll sich schuldig fühlen.
Heute, konstatiert die Autorin, leben wir im Zeitalter des Fans, des Publikums. Menschen begreifen ihre Beziehung zu Künstlern und Künstlerinnen – fragen sie mal ein Swiftie – als identitätsstiftend. Und verleihen dem Biografischen so noch mehr, potenziell destruktive Bedeutung. Paradebeispiel hierfür ist selbstredend die Beziehung zwischen J.K. Rowling und Harry-Potter-Fans.
Letztlich plädiert „Genie oder Monster“ dafür, dass weder das eine noch das andere existiert. Dass man große Kunst nicht mit fehlender Impulskontrolle gleichsetzen kann und Künstler, die Schreckliches getan haben, sich nicht so einfach vom Diskurs ausschließen lassen. Pauschale Urteile sucht man hier vergebens, ebenso wenig findet man einen Leitfaden für das korrekte Verhalten gegenüber unkorrekter Kunst. Claire Dederer tatsächlich geschrieben hat, ist eine kleine Kulturgeschichte der Publikumsscham: Es gibt keinen unschuldigen Kunstgenuss.
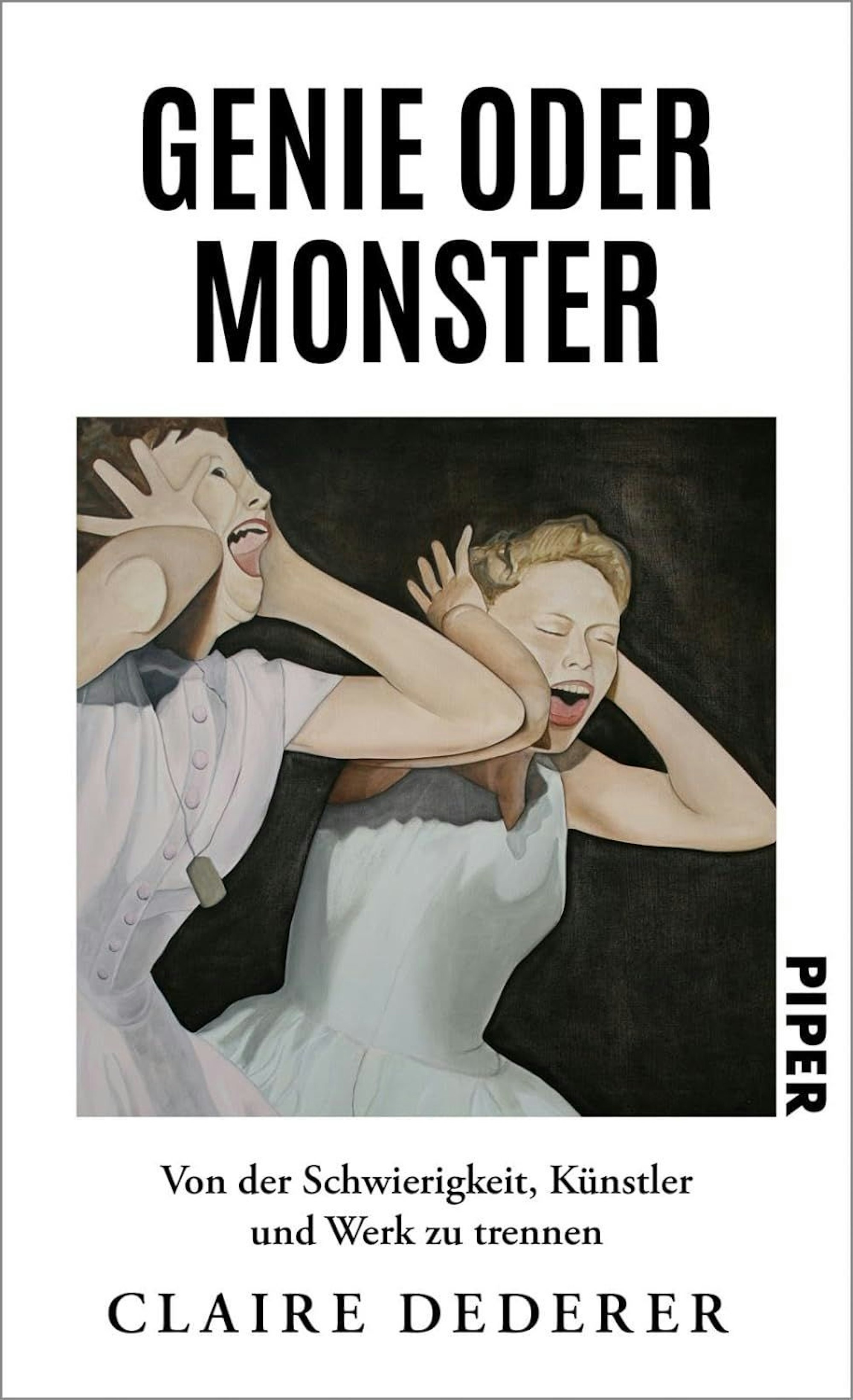
Claire Dederer: „Genie oder Monster: Von der Schwierigkeit, Künstler und Werk zu trennen“, Piper, 320 Seiten, 24 Euro
Copyright: Piper Verlag


