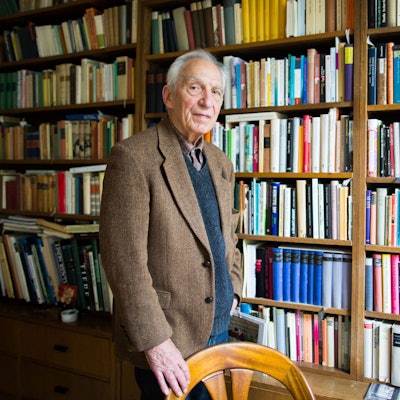Das Ensemble Modern lud in den Stiftersaal des WRM um über die Freiheit der Kunst zu diskutieren.
Wallraf-Richartz-MuseumEs ist schwer, mit Musik jemanden zu beleidigen

Das Ensemble Modern
Copyright: Wonge Bergmann/KölnMusik GmbH
Vielen Kulturschaffenden gefriert ob solcher Botschaften das Blut in den Adern: Donald Trump hat sich jüngst selbst zum Chef des Washingtoner Kennedy Centers – eines der renommiertesten Kulturzentren der USA – wählen lassen und begonnen, mit der im Programm angeblich praktizierten „woken“ Kultur aufzuräumen. „Woke“ ist in den Augen des rechtsradikalen Präsidenten und seinesgleichen alles, was ihm ideologisch nicht in den Kram passt. Sicher, in Deutschland sind wir (noch) nicht so weit, indes wird aus der rechten Ecke auch hier bereits kräftig Stimmung gegen die „woke“ Kultur gemacht.
Da kommt eine aktuelle Köln/Frankfurter Gesprächsreihe unter der Leitfrage „Wie frei ist die Kunst?“ genau richtig. Am Freitag startete sie mit einer Podiumsdiskussion zum Thema „Wie frei sind Ensembles?“ im Stiftersaal des Wallraf-Richartz-Museums. Sicher: In dieser Reihe geht es vorrangig um die aktuelle Situation der (neuen) Musik und ihre Szene, ihre Entwicklungsperspektiven und Marktpositionen – Veranstalter ist das Ensemble Modern. Erkennbar wurden aber im von Leonie Reineke moderierten Gespräch zwischen Christian Fausch, Manager und Geschäftsführer von Ensemble Modern, und Boglárka Pecze, Klarinettistin und Geschäftsführerin von Ensemble Recherche, Probleme und Gefahren, die in diesen Zeiten die Kunstszene – und zumal die freie – insgesamt betreffen.
„Wie frei sind Ensembles?“ fragt die Diskussionsrunde
Das Wort „frei“ erhält in diesem Zusammenhang einen markanten Doppelsinn: Es bezeichnet zum einen den Anspruch, künstlerisch unbehelligt von irgendwelchen Vorgaben, nur den jeweils eigenen Interessen und Intentionen zu folgen. Diesbezüglich hat Musik womöglich, so Reineke, als Kunstform ohne Semantik weniger Möglichkeiten, mit einer konventionellen Moral in Konflikt zu geraten und öffentliches Ärgernis zu erregen als Literatur und Bildende Kunst. Und es ist schwer, mit Musik jemanden grundrechtsrelevant zu „beleidigen“.
Zum anderen bezeichnet es die Tatsache, dass man sich als nicht-öffentliche, mithin private Kulturinstitution auf einem hart umkämpften Markt aus prinzipiell eigener ökonomischer Kraft behaupten muss. Diesbezüglich sind die Klagen über reduzierte und ausbleibende Förderung angesichts der zusammengestrichenen Kulturetats so selbstverständlich, dass sie im Stiftersaal nicht mehr groß zum Thema wurden. Klar: Freiheit der Kunst kann nicht nur an Verboten, sondern auch am Fehlen materieller Unterstützung sterben. Genauer: Dann stirbt nicht die Kunst in einem direkten Angriff, sondern weil ihre Ermöglichungsbedingungen austrocknen.
Was bei uns aufs Pult kommt, wird gespielt.
Im Zentrum des Gesprächs standen indes die inhaltlichen Aspekte der Freiheit der freien Ensembles. Die hat, wie deutlich wurde, einen doppelten Aspekt: Die von äußeren Eingriffen nicht limitierte programmatische Selbstbestimmung und die Art und Weise, wie man intern „Freiheit“ realisiert – in der Diskussion der basisdemokratisch organisierten Formationen über die aufzuführende Musik wie im Umgang mit den von ihnen selbst erteilten Kompositionsaufträgen.
„Was bei uns aufs Pult kommt, wird gespielt“, stellte Flausch fest. Grundsätzlich sei es so, dass man Werke zur Diskussion stelle, zu denen die Ensemblemitglieder durchaus keine einheitliche Meinung zu haben bräuchten. Diese Mittlerfunktion setze nicht totale Selbstidentifikation voraus. Auf jeden Fall aber nehme „die Freiheit des Komponisten“ die höchste Position ein.
Dass es diesbezüglich schon mal hart auf hart zugehen kann, berichtete Pecze unter Bezugnahme auf ein Projekt mit einer südafrikanischen Komponistin. Die habe gleich beim ersten Kontakt gefordert: „Ich will antirassistisch behandelt werden.“ Sie habe in diesem Sinne beim Management des Ensembles einen „Anti-Diskriminierungs-Workshop“ durchgesetzt, mit dem man dann sogar „gute Erfahrungen“ gemacht habe: „Wir sagen vielleicht im Alltag problematische Dinge, derer wir uns gar nicht bewusst sind.“
Kulturpolitische Prioritätensetzungen wie Nachhaltigkeit, Gender und Diversität und Globaler Süden könnten indes auch, gab Flausch zu bedenken, eine de facto freiheitsbeschränkende Wirkung haben. Die zeige sich, wenn Förderanträge unter Hinweis auf die Nichtbeachtung solcher Prioritäten abgelehnt würden. Wenn aber alle, um nur an die Förderung zu kommen, „dasselbe machen, gibt es auch keine Diversität mehr.“
Die Kunstfreiheit kann also von „rechts“ wie von „links“ bedroht sein. Wichtig sei allemal, dass der Künstler ohne die Verpflichtung auf eine kulturpolitisch gesetzte Moral etwas Neues machen könne.
Die nächste Diskussionsrunde der Reihe findet am 9. April, 18 Uhr, im Filmforum statt. Dann sprechen Yilmaz Dziewior, Direktor des Museum Ludwig, und Philharmonie-Intendant Louwrens Langevoort über das Thema „Wie frei sind Veranstaltende?“