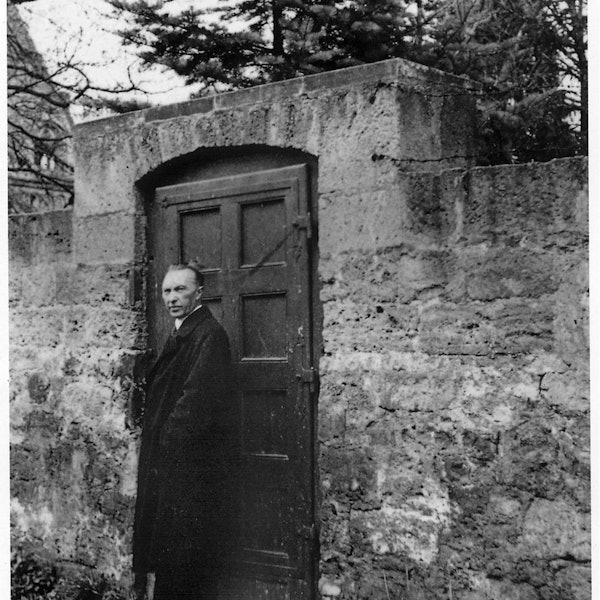Wiedersehen mit Ulbrichts ErbenDüsseldorfer Kunstpalast zeigt vergessene DDR-Kunst

Zu frei und ungestüm für die von der SED geforderte Heroisierung der proletarischen Arbeiterschaft: „Brigadier II“ von Bernhard Heisig (1968/70/79)
Copyright: bpk / Museum der bildenden Küns
- Im Düsseldorfer Kunstpalast wird die Ausstellung „Utopie und Untergang. Kunst in der DDR” gezeigt.
- Im Fokus steht im Westen weitgehend vergessene Kunst.
- Lohnt sich die Schau? Wir haben sie besucht.
Wolfgang Mattheuers Gemälde „Die Flucht des Sisyphos“ (1972), in dem der antike Held in Riesenschritten den grauen Berg herabstürmt und vor dem großen Stein (und mit diesem dem eigenen unabänderlichen Schicksal) davonzulaufen versucht, ist wohl auch deshalb so beliebt und bekannt, weil es sich so vortrefflich als Symbolbild eignet.
Als Metapher für das Leben und einen trostlosen Alltag in der DDR, für Mühsal und Hoffnungslosigkeit schien es auch unsere eigene kritische Sicht auf die Lebensbedingungen im Osten zu bestätigen.
Kunst der DDR war, trotz Mauer und Eisernem Vorhang, in der Bundesrepublik immer irgendwie präsent. So wie Christa Wolf gelesen oder Wolf Biermann und Nina Hagen gehört wurden, so wurden auch DDR-Künstler und ihr Beitrag zur Kunst des 20. Jahrhunderts im Westen durchaus wahrgenommen. Bis ungefähr zur Wende 1989 tauchten Namen wie Willi Sitte und Werner Tübke, Bernhard Heisig und Wolfgang Mattheuer, Arno Rink, Harald Metzkes und andere immer mal wieder auf, wurde Kunst aus Ostdeutschland nicht nur gezeigt, sondern auch gesammelt – sehr prominent etwa von Irene und Peter Ludwig. Für diesen Teil ihrer großen Kunstsammlung war in Oberhausen sogar eigens ein Museum gegründet worden, das Ludwig Institut für Kunst der DDR. Seit 1990 aber ist es deutlich stiller geworden um die ostdeutsche Kunst – man vermied wohl das Label DDR, jetzt, wo alles ganz schnell zusammengehören sollte.
Im Düsseldorfer Kunstpalast sind nun unter dem Titel „Utopie und Untergang. Kunst in der DDR“ rund 130 Bilder, Zeichnungen und einige wenige Skulpturen versammelt, die einen Einblick in die ostdeutsche Nachkriegskunst gewähren. Von den 13 künstlerischen Positionen stammen drei von Frauen; das bildet in etwa die tatsächlichen Zustände ab, Frauen waren offenbar auch in der DDR-Künstlerschaft unterrepräsentiert.
Das könnte Sie auch interessieren:
Eines der erklärten Ziele der Ausstellung sei, sich endlich einmal vorurteilsfrei mit der Kunst der DDR zu beschäftigen, so Generaldirektor Felix Krämer. Und, ergänzt Kurator Steffen Krautzig, die Kunstwerke sollen diesmal im Mittelpunkt stehen, jenseits aller Kategorisierung wie systemkonforme „Staatskunst“ und nonkonforme „Untergrundkunst“, gegenständlich hier, konkret dort. Ein wirkliches Plus dabei wäre, da sind sich alle einig, wenn mit der Ausstellung auch jüngeren Generationen eine Idee von der DDR und der in ihr stattfindenden Kunst vermittelt werden könnte.
In der weitgehend chronologisch eingerichteten Schau lässt sich ablesen, welche verschiedenen Wege und Abzweigungen die Kunst im Osten gegangen ist. Von Wilhelm Lachnits ruhigen Porträts und Stillleben geht es vorbei an Hermann Glöckners geometrischen Farbcollagen zu Gerhard Altenbourgs feinlinigen, religiös fundamentierten Graphitzeichnungen, von Willi Sittes düster bevölkerten Großformaten zu A.R. Pencks Strichmännchen-Bildern und Angela Hampels punkiger „Medea“ und so fort.
Bernhard Heisigs „Brigadier II“ (1968/70/79) erinnert noch an die Erziehungsaufgabe, die die Kunst im SED-Regime hatte, wenngleich die Heroisierung proletarischer Arbeit hier schon nicht mehr ganz astrein gelingen mag. Zu frei und ungestüm die Malerei. Das großformatige Bild „Der Rote Stier“ von Elisabeth Voigt (1893 – 1977) stellt die bäuerliche Magd mit dem wutschnaubenden Stier zwar als eine muskulöse starke Frau aus dem Volk dar. Doch sowohl Heisigs als auch Voigts Werk zeigen eine eigensinnige Bildsprache, die nicht einfach mit dem Schlagwort Sozialistischer Realismus abgehandelt werden kann. Die Dresdener Künstlerin Cornelia Schleime, ganz am Ende des Parcours, zeigt ihre ganz eigene Auseinandersetzungen mit dem Land, das sie 1984 endlich ganz legal verlassen konnte: zeichnerisch bearbeitete Postkarten, Collagen, Fotografien, übermalten Ausreisepapiere.

Willi Sittes Gemälde „Nach der Schicht im Salzbergwerk“ (1982) stammt aus der Aachener Sammlung von Peter und Irene Ludwig.
Copyright: akg-images
Besonders spannend ist der im Westen weniger bekannte, von Künstlerkollegen indes sehr geschätzte Hermann Glöckner (1889 – 1987) mit seinen farbig-abstrakten Kompositionen und einer wunderbaren kleinen Skulptur aus weiß gefassten Holzleisten, „Abtreppung in sieben Stufen“ (1972), die, bescheiden und stolz, in einer beleuchteten Eckvitrine wacht.
Im Jahr 2009 hatte man sich in Oberhausen von der DDR-Kunst getrennt, sie „passe wohl besser nach Leipzig, dort sei das Interesse größer“, hieß es. Hier, im Westen war die Begeisterung für die DDR-Kunst nicht mehr erkennbar. Das mit der Identität und Zugehörigkeit hat offenbar doch ein paar Haken. Umso erfreulicher also, dass jetzt mit der Ausstellung im Düsseldorfer Kunstpalast wieder – oder endlich einmal – die Gelegenheit besteht, Kunst aus Ostdeutschland zu sehen und (besser) kennenzulernen. „Utopie und Untergang. Kunst in der DDR“, Kunstpalast, Düsseldorf, Di.-So. 11-18, Do. 11-21, bis 5. Januar 2020. Der Katalog kostet 29,80 Euro im Museum und 38 Euro im Buchhandel.