Der EU-Zusammenhalt der ersten Wochen bröckelt unter dem Druck von Energiekrise und Inflation. Deutschland muss sich den Vorwurf „Germany first“ gefallen lassen, kommentiert Eva Quadbeck.
Ärger mit DeutschlandIn der EU liegen die Nerven blank

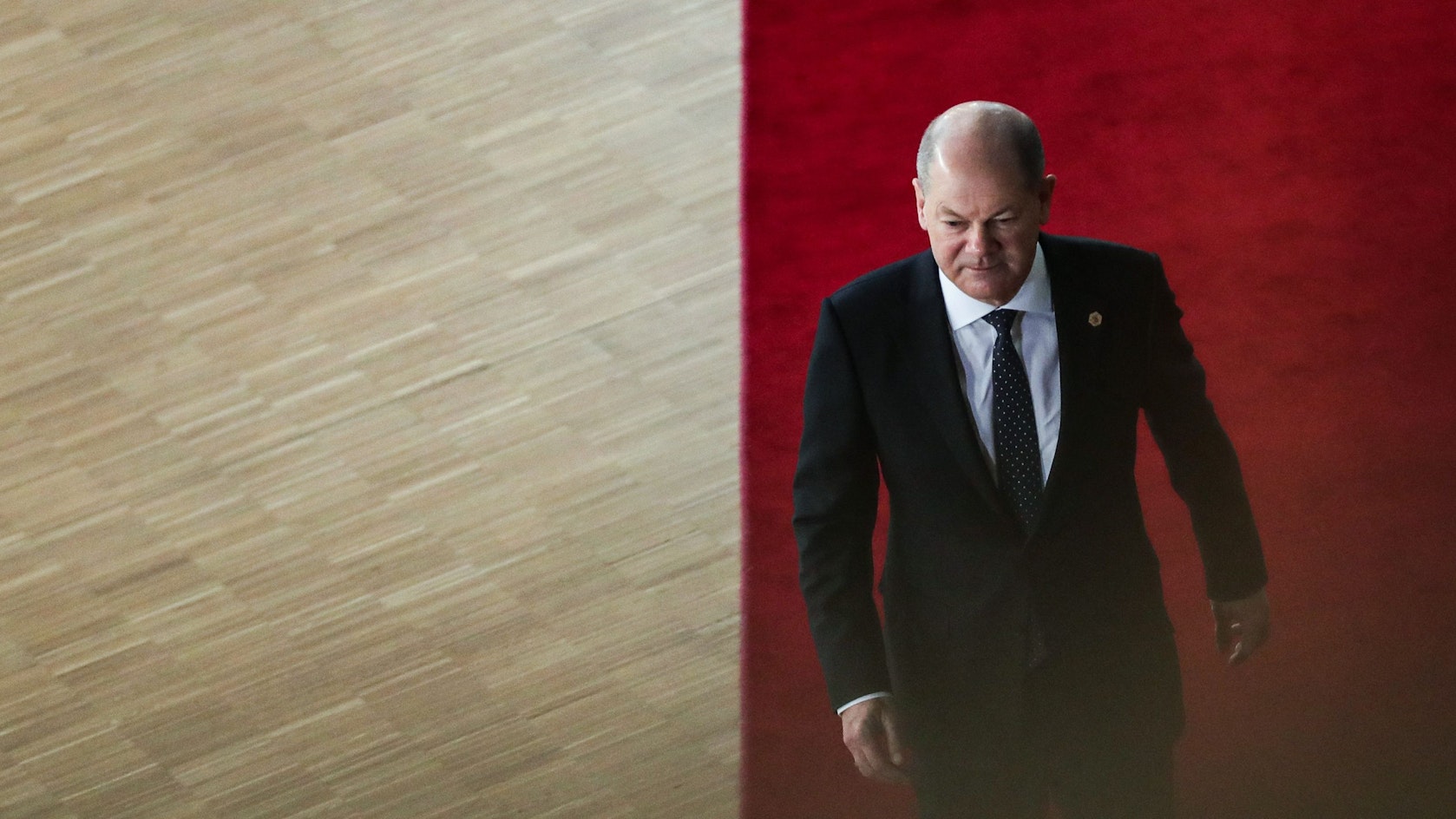
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft zum EU-Gipfel in Brüssel ein.
Copyright: dpa
Der seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine neue Zusammenhalt der Europäischen Union steht inzwischen auf einer harten Bewährungsprobe. Die EU ist in alte schlechte Gewohnheiten zurückgefallen, die sich im Streit ums Geld und um die Verantwortung für Geflüchtete sowie in nationalen Alleingängen zeigen. Nicht zu vergessen der Skandal um die bisherige Vizepräsidentin Eva Kaili. Die Gemeinschaft steht stärker unter Druck denn je, wie der letzte Gipfel der Staats- und Regierungschefs in diesem Jahr offenbart.
Einig ist sich die EU in der Unterstützung der Ukraine gegen Russland und in der Fortsetzung der Sanktionen. Allein die zwingenden Maßnahmen für die Ukraine aufrechtzuerhalten, ist für jede einzelne Nation eine Herausforderung. Wie in Deutschland sinkt auch in anderen Ländern die Bereitschaft der Bevölkerung, die negativen Folgen aus Krieg, Sanktionen, Inflation und Energiekrise hinzunehmen – ein gefundenes Fressen für die Rechtspopulisten. Die Regierungen der 27 EU-Länder werden im kommenden Jahr noch viel Stehvermögen brauchen, um die humanitären, finanziellen und militärischen Hilfen für die Ukraine weiter zu leisten.
Europa steht blank da
Dies ist umso schwieriger, als dass es in der EU nicht wirklich – anders als in der Finanz- und in der Corona-Krise – einen gemeinschaftlichen Plan gibt, wie die dramatischen Auswirkungen für die Volkswirtschaften abgefedert werden sollen. Während die Amerikaner mit einem Subventionspaket für grüne Technologien in Höhe von 369 Millionen Euro ihre Wirtschaft ankurbeln wollen, steht Europa blank da und versucht nun vom Kuchen der amerikanischen Subventionen ein Stück abzuschneiden.
Alles zum Thema Olaf Scholz
- Regierungswechsel Großer Zapfenstreich für Scholz am 5. Mai
- „Direkte Beteiligung“ Deutschlands Kreml droht Merz wegen Taurus – und warnt vor „Eskalation“
- Pistorius bleibt vage SPD könnte bei Taurus von Scholz-Kurs abweichen und Merz unterstützen
- „Bereit zu einem Handelskrieg“ Entsetzen über Trumps Zölle – Scholz spricht von einem „Anschlag“
- Wegen Russland und Trump EU will bis 2030 massiv aufrüsten
- „Furchtbar“ Scharfe Kritik an Scholz’ Statement zu Trump – US-Präsident bleibt weiter auf Putin-Kurs
- Schull- und Veedelszöch & Co. Karnevalssonntag 2025 – Diese Termine stehen in Köln an
Dass Deutschland mit dem „Doppelwumms“ des Kanzlers einen eigenen nationalen Weg geht, löst in der EU aus nachvollziehbaren Gründen Unmut aus. Kein anderes Land in der EU hat die finanzielle Kraft, seine Wirtschaft und Privathaushalte mit 200 Milliarden Euro in der Krise zu stützen – auch nicht mit einer der Bevölkerung entsprechenden vergleichbaren Summe. Die Härte der Deutschen bei den Verhandlungen um die Gaspreisbremse verstärkt den Ärger über Deutschland.
Nun ist es der Job des Kanzlers, das Geld für das eigene Land zusammenzuhalten und die Versorgung mit Gas zu sichern. Sein Job als Regierungschef der Exportnation Deutschland ist es aber auch, für Zusammenhalt in der Europäischen Union zu sorgen, von der Deutschland trotz hoher Zahlungen an die EU enorm profitiert. Das gelingt zurzeit zu wenig, wie das gestörte deutsch-französische Verhältnis zeigt.
Die seit Jahren diskutierte gemeinsame Verteidigungspolitik der EU steckt noch in den Kinderschuhen
Bislang geht auch die Strategie der EU noch nicht auf, sich zwischen den Supermächten China und USA sowie unter dem Druck des Kriegs in der Ukraine größer und multipolar aufzustellen. Der Wunsch nach einer und die Kraft für eine Erweiterung der Europäischen Union Richtung Osten ist nicht groß genug, dass die EU in absehbarer Zeit tatsächlich neue Länder aufnehmen kann. Zumal sich die EU mit ihrem Einstimmigkeitsprinzip selbst im Weg steht.
Einen Rückschlag gab es auch beim Gipfel mit den südostasiatischen Staaten der Asean. Drei Länder – Vietnam, Laos und Thailand – waren noch nicht einmal bereit, den Krieg Russlands gegen die Ukraine scharf zu verurteilen.
Der Krieg in der Ukraine lähmt die EU zudem auf ihrem Weg zu den dringend notwendigen Reformen. Die schon seit Jahren diskutierte gemeinsame Verteidigungspolitik steckt noch in den Kinderschuhen. Der Versuch, der EU auf der Weltbühne außenpolitisch eine einheitliche Stimme zu geben, scheitert schon daran, dass Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel nicht in der Lage sind, an einem Strang zu ziehen.


