Der Kölner Soziologieprofessor Tim Engartner kritisiert das Nebeneinander von privater und gesetzlicher Krankenversicherung in Deutschland.
GastbeitragKölner Soziologe: „Deutsches Gesundheitssystem teuer, kompliziert und ungerecht“

Blick in eine Intensivstation
Copyright: dpa
Jahr für Jahr ereilt uns dieselbe Hiobsbotschaft: Die Gesundheitsausgaben steigen, ohne dass sie durch die Einnahmen der Krankenkassen gedeckt sind.
Für das kommende Jahr wird sich das Defizit der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) auf rund 17 Milliarden Euro belaufen. Zum 1. Januar 2024 steigen daher die Krankenkassenbeiträge erneut an – um 0,1 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent. In der privaten Krankenversicherung (PKV) steigen die Beiträge um durchschnittlich sieben Prozent, in nicht wenigen Fällen sogar um mehr als zehn Prozent. Das bringt vor allem ältere Versicherte in Bedrängnis, die die Mehrkosten nicht stemmen und oftmals nicht mehr in die GKV wechseln können.

Tim Engartner, Professor für Soziologie an der Universität zu Köln
Copyright: Universität zu Köln
Zugleich wird durch die Koexistenz von privater und gesetzlicher Krankenversicherung ein erfolgversprechender Weg zur auskömmlichen Finanzierung des Gesundheitssystems behindert: die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze von aktuell 59.850 Euro pro Jahr, bis zu der Sozialversicherungsbeiträge fällig werden. Für Einkommen jenseits dieser Grenze werden keine Beiträge gezahlt – de facto eine willkürlich festgelegte Entkoppelung vom Prinzip der solidarischen Finanzierung. Jedoch schreckt die Regierung regelmäßig vor einer deutlichen Anhebung zurück, weil sie dadurch eine Abwanderung von Spitzenverdienenden in die PKV fürchtet.
In Europa einmaliges Mischsystem
Aber nicht nur aus diesem Grund stellt das komplizierte und in Europa einmalige Mischsystem aus privater und gesetzlicher Krankenversicherung eine finanzielle Belastung dar, die sich das Land angesichts der unzähligen Herausforderungen im Gesundheitswesen nicht länger leisten kann. Bereits im Jahr 2020 wies eine viel beachtete Studie der Bertelsmann-Stiftung nach, dass die PKV die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler zwischen neun und elf Milliarden Euro kostet, was einen Großteil der aktuellen Finanzierungslücke darstellt.
Wenn sich alle derzeit Privatversicherten – das heißt, vor allem Gutverdienende, Beamtinnen und Beamte sowie einkommensstarke Selbstständige – am Solidarsystem der GKV beteiligten, dann wäre die nun anstehende Beitragserhöhung nicht erforderlich. Die positiven finanziellen Effekte ergeben sich aus den deutlich höheren Einkommen der privat Versicherten – sie verdienen im Schnitt 56 Prozent mehr als gesetzlich Versicherte – und ihrem durchschnittlich besseren Gesundheitszustand. Durch die Zusammenlegung des dualen Systems käme es zu einer breiteren und effizienteren Risikostreuung, die dem ökonomischen Versicherungsprinzip zugrunde liegt und dem moralischen Solidarprinzip (eher) gerecht wird.
Die Mehrheit der Deutschen empfindet das System als höchst ungerecht
Die überwiegende Mehrheit der Deutschen empfindet das derzeitige System als höchst ungerecht. Immer wieder belegen empirische Studien, dass gesetzlich Versicherte (immerhin rund 90 Prozent der Bevölkerung) im aktuellen dualen System gegenüber privat Versicherten Benachteiligungen erfahren. Jüngst wies die Marburger Soziologin Andrea Breitenbach mittels Feldexperimenten nach, dass gesetzlich Versicherte durchschnittlich 15 Tage länger auf einen Arzttermin warten müssen als privat Versicherte.
Daher kann es kaum verwundern, dass eine Mehrheit der Bundesbürgerinnen und -bürger ein einheitliches Versicherungssystem klar bevorzugt. Laut einer repräsentativen Umfrage von infratest dimap im Auftrag des ARD-Magazins „Monitor“ finden 69 Prozent, häufig unabhängig von Parteipräferenzen, das viel diskutierte und von SPD, Grünen und Linkspartei favorisierte Konzept der Bürgerversicherung „gut“ bis „sehr gut“. Leider hat es die überaus populäre und dem Gerechtigkeitssinn der Bevölkerung entsprechende Idee nicht in den Koalitionsvertrag der Ampelregierung geschafft – die FDP hat ihrem Ruf als Klientelpartei der Privatversicherer wieder mal alle Ehre gemacht.
Vollends öffentliche Systeme bringen die besten Leistungen für alle
Ein Beleg für die Sinnhaftigkeit einer solidarischen Bürgerversicherung ergibt sich auch aus internationaler Perspektive: Mit dem dualen Krankenversicherungssystem steht Deutschland unter den entwickelten Volkswirtschaften nahezu allein dar – neben dem Negativbeispiel USA, die sich das teuerste Gesundheitssystem der Welt leisten und dabei ähnlich schlechte Ergebnisse in puncto Lebenserwartung und vermeidbare Sterblichkeit aufweisen wie Kolumbien und Mexiko.
Im Ländervergleich zeigt sich zudem, dass vollends öffentliche Systeme wie jene in Schweden, Norwegen oder Japan die besten Gesundheitsleistungen erbringen – und zwar für alle in gleichem Maße. Anders sieht es in der Schweiz aus, die gelegentlich auch hierzulande als Vorbild genannt wird. Zwar ist das vollkommen privatisierte Gesundheitssystem ebenfalls qualitativ sehr hochwertig, aber die zu erbringenden Eigenleistungen sind signifikant höher. So zahlen die Schweizerinnen und Schweizer im Schnitt 5,5 Prozent ihres verfügbaren Haushaltseinkommens für die ausschließlich privaten Gesundheitsleistungen und rangieren damit auf einem OECD-Spitzenplatz.
Gesundheit ist zum Luxusgut geworden
In der Alpenrepublik ist Gesundheit dadurch vor allem für die Mittelklasse zum Luxusgut geworden. Erschwerend kommt hinzu, dass auch dort unlängst die Versicherungsbeiträge deutlich angehoben wurden, weil die privaten Versicherungskonzerne mit den Reserven ihrer Kundinnen und Kunden an den Finanzmärkten spekuliert und dort hohe Verluste eingefahren hatten.
Die Integration aller Krankenkassen in ein einheitliches öffentliches System mit der Möglichkeit privater Zusatzversicherungen wäre nicht nur sozial gerecht, sondern auch günstiger, wie das Beispiel der Niederlande beweist. Dort wurde das ineffiziente Nebeneinander von gesetzlicher und privater Krankenversicherung 2006 zugunsten eines Einheitssystems abgeschafft. Voraussetzung dafür hierzulande wäre jedoch eine Anpassung der ärztlichen Vergütungssätze.
Solange die Honorare für gesetzlich Versicherte keine auskömmliche Finanzierung der praktizierenden Ärztinnen und Ärzte gewährleisten, wird es weiterhin eine Zwei-Klassen-Versorgung geben. Die lediglich zehn Prozent Privatversicherten decken 23 Prozent der Kosten. Eine Anhebung der Sätze der ärztlichen Gebührenordnung ist daher überfällig. Diesbezüglich darf man hoffen, dass der jüngste Streik der Ärzteschaft politisch Wirkung zeigt.
Die Autoren
Tim Engartner ist Professor für Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt ökonomische Bildung im Rahmen des vom Land Nordrhein-Westfalen geförderten Gateway Exzellenz Start-up Centers an der Universität zu Köln.
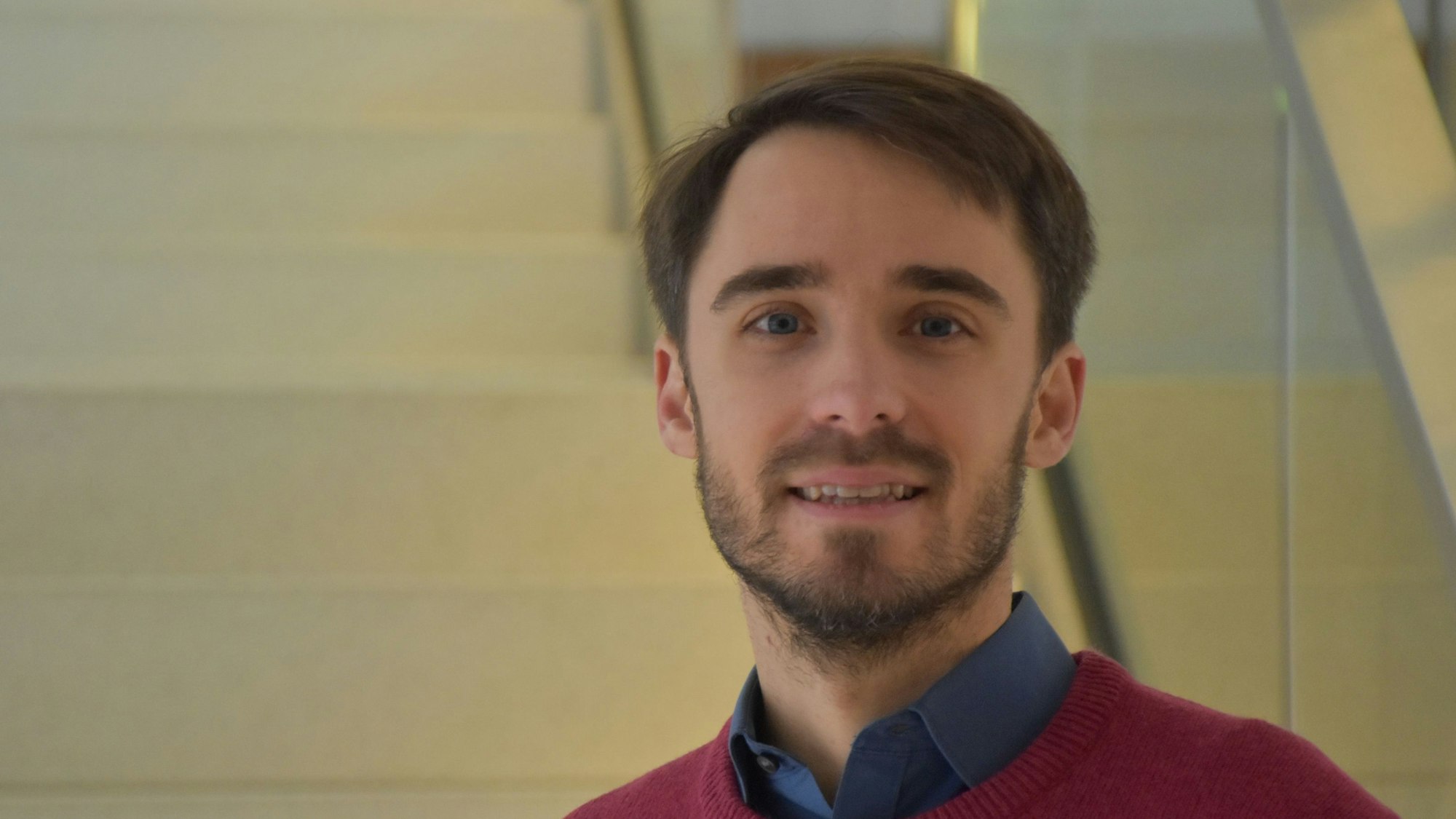
Michael Schedelik
Copyright: Goethe-Universität Frankfurt
Michael Schedelik ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Arbeitsbereich „Internationale Beziehungen und Internationale Politische Ökonomie“ der Goethe-Universität Frankfurt am Main sowie assoziiertes Mitglied im DFG-Graduiertenkolleg „Standards des Regierens“.

