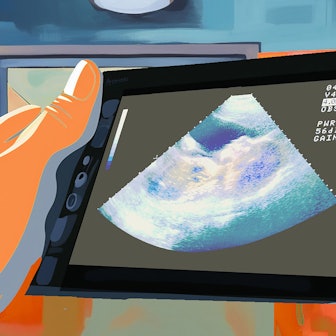Schwangere werden abgewiesen, in den Kliniken fehlt Personal. Gleichzeitig ist der Innovationswille groß. Über die Geburtshilfe in Köln.
Die GeburtslotterieWie gut bin ich aufgehoben, wenn ich in Köln ein Kind auf die Welt bringe?

Die Bedürfnisse werdender Eltern sind sehr unterschiedlich.
Copyright: KStA-Montage/Midjourney
Ob eine Geburt gut läuft oder nicht, hängt von vielen Faktoren ab. Manche davon sind subjektiv, wie das Empfinden und die Erwartungen werdender Eltern. Andere sind unplanbar, wie plötzliche Komplikationen. Wieder andere aber sind objektiv erfassbar. Sie betreffen die Qualität der Geburtshilfe. Und von solchen Faktoren handelt dieser Artikel. Um eine Frage zu beantworten, die sich seit dem Tod einer Mutter nach ihrer Entbindung an der Uniklinik Köln vermutlich nicht nur werdende Eltern stellen: Wie gut bin ich aufgehoben, wenn ich in einer der Geburtskliniken in dieser Stadt ein Kind auf die Welt bringe?
Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, fahre ich in das Krankenhaus Porz am Rhein. Vor mir sitzt die Chefärztin der Geburtshilfe, Patricia Van de Vondel. Sie hat eine Nachtschicht hinter sich, ist aber hellwach. Sie sagt: „Wir brauchen eine grundlegende Reform der Geburtshilfe – und zwar nicht erst seit gestern, sondern seit 25 Jahren.“
Ärztinnen und Ärzte wie Van de Vondel stehen vor einer Gratwanderung. Ihr Fachgebiet ist in den vergangenen Jahren so drastisch heruntergewirtschaftet worden, dass es schon länger auf Kosten der Mitarbeitenden und auch der werdenden Eltern geht. Wie bloß darüber sprechen, ohne der eigenen Klinik und damit sich selbst zu schaden? „Vor allem“, sagt Van de Vondel, „wollen wir schwangeren Frauen keine Angst machen. Die Geburtshilfe in Köln arbeitet auf einem sehr hohen Niveau. Aber sie könnte trotzdem viel besser sein.“
Wie dieses besser ausfallen soll, darüber wird derzeit viel diskutiert. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will die Krankenhauslandschaft neu aufstellen. Bei alledem im Fokus: die Geburtshilfe. Denn hier zeigt sich das Versagen der bestehenden Regelungen besonders. Gleichzeitig gibt es Zweifel, ob seine Pläne funktionieren werden. NRW-Gesundheitsminister Laumann hat einen eigenen „Krankenhausstärkungsplan“ vorgelegt. Eine Einigung zwischen Bund und Ländern? Nicht in Sicht.
Schwangere sollten immer zwei oder drei Geburtskliniken ins Auge fassen
Und während die Politiker noch debattieren, schellt in Porz oder anderorts wieder eine Frau unter Wehen an der Kreißsaal-Tür. In der Hoffnung, dass sie aufgenommen wird. Denn wenn eine Geburtsstation vollständig ausgelastet ist, hilft auch eine vorangegangene Anmeldung nicht. Manchmal liegt das in der Natur der Sache: Geburten lassen sich schlecht planen, sie finden zu früh oder zu spät und rund um die Uhr statt. Was seit der Corona-Krise außerdem zugenommen hat, sind krankheitsbedingte Engpässe – und zudem fehlendes Fachpersonal, erklärt die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) in einer gerade veröffentlichten Stellungnahme. Es sei deswegen entscheidend, bei einer Neustrukturierung der Krankenhauslandschaft besonders auf die ausreichende Versorgung von Schwangeren, Gebärenden und Neugeborenen zu achten.
Geburtsstationen haben einen ähnlichen Status wie eine Notaufnahme, sie dürfen genau genommen niemanden abweisen, vor allem nicht, wenn sofortiges Handeln geboten ist. Ärztinnen und Ärzte mahnen deswegen, besser nicht zum Telefon zu greifen, wenn die Wehen starten, sondern zu der Klinik hinzufahren. Um sich dort dann weiterhelfen zu lassen. Soweit die Theorie.
In der Realität erleben es Schwangere immer wieder, dass man ihnen am Telefon sagt, die Kreißsäle seien leider belegt, sie sollten es woanders probieren. Oder die Frauen werden eilig in eine andere Geburtsklinik verlegt. „Ich würde deswegen jeder Frau empfehlen, immer mindestens zwei, vielleicht sogar drei Kölner Kliniken ins Auge zu fassen, also einen Plan B zu haben“, rät Katharina Desery, Sprecherin des Vereins „Mother Hood“. „Gebären hat viel mit Sicherheit zu tun. Wenn werdende Eltern sich nur auf eine Klinik vorbereitet haben und dann plötzlich doch umschwenken müssen, kann das in einer so emotionalen Situation sehr viel Stress auslösen.“
Die Initiative „Mother Hood“ setzt sich für eine bessere Versorgung von Mutter und Kind während der Schwangerschaft und Geburt ein und ist inzwischen zur Anlaufstelle für jene geworden, die ihr Geburtserlebnis als belastend, wenn nicht sogar traumatisierend empfunden haben. „Aus Studien wissen wir, dass das auf etwa 30 Prozent der Mütter zutrifft“, sagt Desery. Sie lebt in der Nähe von Köln, kennt die Situation in der Region also gut. Man könne werdenden Familien nicht diese eine Geburtsklinik in Köln und Umgebung empfehlen, sagt sie, weil es je nach aktueller Personalsituation in jeder Klinik gut oder nicht so gut laufen kann.
Hinzu kommt, dass sich die Bedürfnisse werdender Eltern so stark unterscheiden, dass es kaum ein Patentrezept für eine glückliche Geburt gibt. Manche wünschen sich so wenig Intervention wie möglich, andere eine engmaschige medizinische Betreuung. Ginge es nach Desery, müsste die Geburtshilfe die Flexibilität entwickeln, auf diese Vielfalt an Bedürfnissen reagieren zu können. „Es kann nicht sein, dass es hierzulande reine Glückssache ist, ob jemand ein gutes Geburtserlebnis hat oder nicht“, findet sie. „Ein Kind zu bekommen, ist doch kein Lotto-Spiel.“
Auch Patricia Van de Vondel aus Porz kritisiert: „Wir schicken uns in dieser Stadt schon viel zu lange die Frauen hin und her“. Das sei zwar zwischen den Kölner Kliniken sehr gut organisiert, aber für die Schwangeren trotzdem belastend. Besonders, wenn sie dann in den Kliniken auf Ärztinnen und Ärzte, auf Hebammen und Pflegepersonal treffen, die auch alle an der Belastungsgrenze arbeiten. Um daran etwas zu ändern, brauche es mehr als nur eine bessere Bezahlung im Gesundheitswesen, sagt Van de Vondel.
Hebammen, Fachärzte, Pflegende – in Geburtskliniken fehlt Personal
Allen voran betreffe das die Hebammen, von denen viele inzwischen eine selbstständige Tätigkeit dem Job im Krankenhaus vorziehen würden. Van de Vondel fordert – wie eigentlich jede und jeder aus ihrem Fachbereich – eine gesicherte 1-zu-1 Betreuung durch eine Hebamme während der Geburt. „Ich bin überzeugt, dass Frauen dann weniger Schmerzmittel brauchen würden und auch weniger komplizierte Verläufe hätten.“ Von diesem Ideal ist die Hebammenarbeit allerdings sehr weit entfernt, berichten Kölner Hebammen anonym im Gespräch mit dem Kölner Stadt-Anzeiger (Mehr zu der Arbeitssituation der Hebammen lesen Sie hier).
Aber nicht nur der Hebammenmangel sei das Problem, sagt Van de Vondel. Es müssten insgesamt mehr Menschen in der Geburtshilfe arbeiten, auch auf den Wochenbettstationen. „Die Mütter und ihre Kinder sind ja nicht krank – aber sie haben sehr viele Fragen und brauchen rund um die Uhr Unterstützung.“ Zudem würden die Pflegenden nicht nur eine, sondern immer gleich mehrere Menschen betreuen, also die Mutter, das Baby und womöglich auch noch einen besorgten Partner oder eine besorgte Partnerin. Auch deswegen stimme der Personalschlüssel auf den Wochenbettstationen häufig nicht. Die Krankenhäuser rechneten diese Mehrfachbelastung nicht mit ein.
Und auch eine Anzahl von fünf Oberärztinnen und -ärzten wie in Porz sei zwar mehr als in manch anderem Haus – aber bei der hohen Arbeitsbelastung im Schicht- und Wochenenddienst nicht genug, sagt Van de Vondel. Zumindest nicht, wenn der Beruf Geburtshelferin oder Geburtshelfer für angehende Ärzte dauerhaft attraktiv bleiben soll. Um Nachwuchs zu finden, müssten andere, familienfreundlichere Arbeitsmodelle her. Und eine deutlich größere Wertschätzung des Fachbereiches.
Fehlendes Personal in Kliniken durch Zeitarbeitskräfte zu ersetzen, sollte gar nicht erlaubt sein, findet Van de Vondel. „Auf einer Geburtsstation brauche ich ein eingespieltes Team aus Hebammen, Geburtshelferinnen und Geburtshelfern und Pflegerinnen und Pflegern.“ Wenn das nicht gegeben sei, könne es in einer Notfallsituation zu Unsicherheiten kommen, die die optimale Versorgung gefährden.
Ginge es nach der Geburtshelferin aus Porz, sähe die Geburtshilfe der Zukunft ohnehin ganz anders aus. Anstatt viele zersplitterte Einzelkliniken in Köln gäbe es ein großes Haus, das die gesamte Expertise der Geburtshilfe vereint. Vom rein hebammengeführten Kreißsaal für eine intime, interventionsarme Geburt bis hin zum Perinatal-Zentrum Level 1 für Risiko- und Frühgeburten und einer zugehörigen Kinder-Intensivstation. 15,8 Millionen Euro hat das Krankenhaus Porz vom Gesundheitsministerium NRW erhalten, um ein neues Mutter-Kind-Zentrum zu bauen. Es ist derzeit allerdings unklar, wie es an dem Standort weitergeht. Das stiftungsfinanzierte Haus konnte nur durch ein Darlehen der Stadt Köln eine drohende Insolvenz abwehren.
„Gestuftes Versorgungskonzept“ nennt Berthold Grüttner die Überlegungen, die Expertise der Geburtshilfe besser zu bündeln. Grüttner ist Leitender Oberarzt der Geburtshilfe an der Uniklinik Köln. Die Zusammenarbeit mit dem rein hebammengeführten „Lindenthaler Geburtshaus“ sei ein erster Schritt in diese Richtung, findet er. Vor einigen Jahren noch, erklärt Grüttner, habe die Uniklinik ihren Versorgungsauftrag vor allem im Bereich der Risikoschwangerschaften gesehen, darauf ist die Geburtsstation damals ausgelegt worden. „Vieles, was sie in kleineren Kliniken finden, gibt es deswegen bei uns so nicht, wie stets verfügbare und gemütliche Familienzimmer.“ Das soll sich bald ändern. Auch an der Kerpener Straße ist ein großes „Centrum für Familiengesundheit“ geplant, die Bauarbeiten haben schon begonnen.
Geburtskliniken wurden geschlossen, Betten sind reduziert worden
„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass auch Frauen ohne Risikoschwangerschaft der Sicherheitsaspekt unter der Geburt immer wichtiger geworden ist“, sagt Grüttner. Entsprechend groß sei inzwischen die Zahl derer, die in der Uniklinik entbinden wollten, 1979 Kinder kamen hier 2022 auf die Welt, 2020 waren es sogar 2230. „Natürlich freuen wir uns über unkomplizierte Geburten, aber gleichzeitig kommen wir so auch an unsere Belastungsgrenze, weil sich alle auf uns verlassen. Wenn andere keine Kapazitäten mehr haben, dann senden sie die Frauen halt in die Uniklinik.“
Die Nachfrage ist auch deswegen größer geworden, weil die Menschen in Deutschland seit 2010 tendenziell wieder häufiger Kinder bekommen. Im Jahr 2005 wurden in Köln zum Beispiel 9.411 Kinder geboren, im Jahr 2018 stieg diese Zahl auf 11.851. Unterbrochen wurde dieser Trend durch die Corona-Pandemie, 202o reduzierte sich die Zahl der Lebendgeborenen auf 11.071, 2021 stieg sie dann wieder auf 11.614.
Gleichzeitig wurden in der Region seit 2006 elf Geburtskliniken geschlossen. In ganz NRW hat sich die Zahl der Kliniken mit Geburtshilfe in den Jahren 2002 bis 2017 von 229 auf 122 reduziert. Auch die Zahl der verfügbaren Betten in der Geburtshilfe ist in NRW deutlich kleiner geworden. Diese Reduktion betrifft kleinere Krankenhäuser außerhalb von Ballungszentren wie Köln nochmal stärker. Das bedeutet: Auch Schwangere aus der Umgebung wenden sich zunehmend an die Kliniken in der Stadt.
Als „kaltes Kliniksterben“ bezeichnet Markus Schmidt diesen Prozess: An einer Stelle wird abgebaut, an anderer Stelle nicht für einen entsprechenden Ausgleich gesorgt. Schmidt ist nicht nur Chefarzt der Geburtshilfe an den Sana Kliniken Duisburg, er sitzt als Vertreter der Pränatal- und Geburtsmedizin auch im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Den strukturellen Problemen in dem Fach sei nur mit einer stärkeren Zentralisierung und einer besseren Vernetzung der Geburtskliniken untereinander beizukommen, sagt auch er. Gleichzeitig müsse sichergestellt werden, dass in ländlichen Regionen die Grundversorgung aufrechterhalten wird. Vor allem müsse die Geburtshilfe anders finanziert werden.
Geburten werden seit Jahren schon nicht ausreichend finanziert
Denn das ist das Kernproblem: Geburten sind für Kliniken ein Verlustgeschäft, besonders für die mit einer geringen Anzahl an Entbindungen im Jahr, erklärt Berthold Grüttner von der Uniklinik. Viele der kleineren Kliniken hätten ihre Geburtsstation aus diesem Grund geschlossen. Das hat mit dem Fallpauschalensystem zu tun, über das die Krankenkassen zurzeit die Behandlungskosten erstatten. Aus Erfahrung wissen Ärzte wie Grüttner, dass für eine vaginale Geburt circa 1.700 Euro erstattet werden. Und zwar völlig unabhängig davon, ob diese Geburt vier oder 14 Stunden dauert, ob das Kind relativ unkompliziert herauskommt oder aber mit einer Saugglocke geholt werden muss. „Das zahlen Sie so auch bei einem großen Service in Ihrer Autowerkstatt – nur, dass es hier um Menschen geht, bei uns ein riesiges Team aus Hebammen, Fach- und Oberärzten zu jeder Tag- und Nachtzeit bereitsteht, Sie ohne Anmeldung kommen können und wir in Millionenhöhe haften, wenn etwas schiefgeht“, sagt Grüttner. Bundesgesundheitsminister Lauterbach plant, zumindest die sogenannten Vorhaltekosten mit eigenen Pauschalen zu versehen. Das sind die Zeiten, in denen das Personal anwesend sein muss, aber keine Geburt stattfindet. Grüttner glaubt nicht, dass dieser Schritt reicht, um die Geburtshilfe ausreichend zu finanzieren.
Grüttners Bereich steht auch deswegen im Fokus, weil im Sommer 2022 eine junge Frau nach der Entbindung unter bislang ungeklärten Umständen gestorben ist. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Kommentieren möchte der Arzt das Verfahren nicht. Aber ist der Fall nicht dennoch ein Warnsignal für ein ganzes System, das kurz vor dem Kollaps steht? „Nein“, sagt Grüttner knapp. Nein, sagen auch Schmidt von der DGGG und Van de Vondel aus Porz. Sie fügt hinzu: Unabhängig von dem Fall in Köln gebe es immer ein Restrisiko, dass während einer Geburt etwas passiert, auch wenn das keine Frau gerne hören möchte. Neun Fälle von Müttersterblichkeit wurden im Jahr 2021 in NRW erfasst. Eine umfassendere Statistik, die auch Fälle nach der Entlassung aus einer Klinik einbezieht, gibt es nicht.
Inwiefern sich Investitionen in die Geburtshilfe auszahlen, kann man derweil in der Kölner Südstadt beobachten. Hier steht dieses eine Krankenhaus, dessen Namen in dem Flüsternetzwerk der werdenden Mütter fast immer fällt: das Krankenhaus der Augustinerinnen, kurz „Klösterchen“. Anders als in manch anderen Häusern habe man die Geburtshilfe in den vergangenen Jahren strategisch erweitert, erklärt Jan Schmolling, Chefarzt der Frauenklinik. Und auf moderne Konzepte gesetzt, wie das Bonding über Haut-zu-Haut-Kontakt und eine bessere Einbindung der Väter in den Geburtsprozess. Vor drei Jahren wurde die vollständig renovierte Entbindungsstation mit sechs Kreißsälen und zwei weiteren Operationssälen eingeweiht, inzwischen ist das vergleichsweise kleine Krankenhaus im Kölner Süden neben der Universitätsklinik das geburtenstärkste Haus der Stadt.
„Mit unseren Umbaumaßnahmen wollten wir nicht nur die idealen Räumlichkeiten für Gebärende schaffen, sondern auch optimale Arbeitsbedingungen für unserer Hebammen, Ärztinnen, Kinder-Krankenschwestern und auch Sporttherapeuten und Sozialarbeiter“, sagt Schmolling. Das Krankenhaus unweit der Severinstraße ist bei werdenden Eltern auch deswegen beliebt, weil sie in der mit der Klinik eng kooperierenden hebammengeleiteten Elternschule „Neue Kölner“ direkt nebenan Kurse zur Geburtsvorbereitung und Nachsorge besuchen können.
Ob eine Geburt gut oder auch nicht so gut läuft, hängt also in der Tat von vielen Faktoren ab. Auch deswegen sei es wichtig, findet Katharina Desery von „Mother Hood“, dass eine Verbesserung der Situation nicht nur eine bloße Absichtserklärung seitens der Kliniken und auch der Politik bleibe. Sondern, dass die vielen guten Empfehlungen und Konzepte endlich umgesetzt werden. Denn es mangelt ja nicht an dem Engagement der Menschen, die in der Geburtshilfe arbeiten. Es fehlen nur die richtigen Strukturen – und das Geld.
Mitarbeit und Datenrecherche: Sandra Liermann