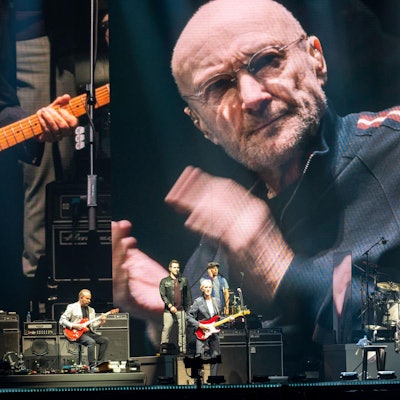Literatunobelpreisträger in Köln„Die Sprache gehört nicht den Kolonialherren“

Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah in Köln
Copyright: Max Grönert
Herr Gurnah, vor fünf Monaten wurde Ihnen der Nobelpreis für Literatur zuerkannt. Wie lange haben Sie gebraucht, um zu realisieren, dass Sie sich jetzt in der Gesellschaft von Yeats, Shaw und Thomas Mann befinden?
Abdulrazak Gurnah: Jedenfalls keine fünf Monate. Jeder weiß, was der Nobelpreis bedeutet. Erst recht, wenn man in dem Beruf tätig ist, den ich ausgeübt habe, nämlich Literatur und Schreiben zu lehren. Man weiß, dass viele der Menschen, die oder deren Arbeit man bewundert, auf dieser Liste stehen. Man weiß, dass man wegen der Qualität und der Leistung seiner Arbeit ausgewählt wurde, und es ist eine wunderbare Sache, wenn man das erfährt: Du bist jetzt Teil dieses Teams.
Als der Preis bekannt gegeben wurde, war keines Ihrer Bücher in Deutschland erhältlich.
Ich weiß nicht, wo meine Bücher erhältlich sind. Ich schreibe sie und die Leute veröffentlichen sie, was absolut wunderbar ist. Und wenn sie dann veröffentlicht sind, bin ich glücklich. Das bedeutet, dass das Buch nicht verloren ist. Es ist nicht etwas, das man unter dem Bett in einem Pappkarton aufbewahrt hat. Das dramatischste Ergebnis des Preises, abgesehen von meiner Freude, ist natürlich, dass diese Bücher neu aufgelegt werden.
Die Nobelpreis-Jury schreibt, dass eines Ihrer übergreifenden Themen das Schicksal des Flüchtlings in der Kluft zwischen den Kulturen und Kontinenten sei. Sie haben Sansibar nach der Revolution in den 1960er Jahren verlassen. Damals wurden viele Menschen getötet. Und doch wollen Sie sich nicht als Flüchtling bezeichnen.
Weil ich die Bedingungen betrachte: Ein Flüchtling ist jemand, der vor Gewalt und Krieg flieht und keine andere Möglichkeit hat. Das ist es, was einen zum Flüchtling macht. In gewisser Weise ist das ein nobler Zustand.
Abdulrazak Gurnah, geboren 1948 im Sultanat Sansibar, wurde 2021 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Er hat bislang zehn Romane veröffentlicht. Der Professor emeritus für englische und postkoloniale Literatur der University of Kent lebt im englischen Canterbury.
Auf der lit.Cologne las Gurnah am Mittwochabend. Im Dezember ist bereits sein Roman „Das verlorene Paradies“ bei Penguin (336 Seiten, 25 Euro) erschienen. Jetzt ist die nächste deutsche Übersetzung herausgekommen: „Ferne Gestade“, Penguin, 416 Seiten, 26 Euro.
Sie aber hatten das Gefühl, eine Wahl zu haben?
So fühlte es sich für mich an. In meinem Land herrschten zwar alle möglichen Arten von Schikanen und Terror. Aber ich war in keiner Weise direkt bedroht. Niemand hat zu mir gesagt: Wenn du das nicht tust, werde ich dich töten. Niemand hat mein Haus bombardiert, obwohl ein oder zwei Verwandte von mir im Gefängnis saßen und ein oder zwei meiner Schulkameraden verletzt wurden. Ich bin weggegangen, weil ich weggehen wollte, weil ich ein besseres Leben wollte. Wenn ich sage, dass ich kein Flüchtling bin, dann, weil ich es nicht verdiene, als Flüchtling bezeichnet zu werden.
Gerade ist ihr Roman „Ferne Gestade“ erschienen. Welche der Figuren darin würden Sie als Flüchtling bezeichnen?
Ich würde sagen, dass Latif kein Flüchtling ist. Dass ist derjenige, der von Sansibar in die DDR reist und dann beschließt zu gehen. Er sagt, er sei ein Flüchtling, weil das eine Form der Erzählung ist, die man konstruiert. Ich bin nicht einfach ein anderer Ausländer, ich bin ein Flüchtling. Ich denke, dass das Wort „Flüchtling“ heute etwas zu locker verwendet wird und jeden meint, der ein Fremder ist und um Gastfreundschaft bittet. Ich denke aber, dass es wichtig ist, uns immer wieder daran zu erinnern, dass Flüchtlinge etwas ganz Ernstes ist. Wir können sie nicht wegschicken. Sie sind Menschen und unsere Menschlichkeit verlangt von uns, dass wir auf sie reagieren.
Das Spielfeld der Europäer
Dennoch ertragen die Menschen unglaubliche Nöte, selbst wenn sie aus wirtschaftlichen Gründen fliehen.
Sie suchen ein besseres Leben, weil ihr Leben vielleicht fast unerträglich ist. Wenn man darüber nachdenkt, haben Millionen von Europäern in den letzten 300 Jahren genau das getan, wenn sie an andere Orte der Welt gegangen sind. Die Idee, umzuziehen und auszuwandern, um etwas Besseres für sich selbst zu finden, ist in der Geschichte der Menschheit nichts Neues. Neu ist, dass diese Migrationsbewegung in den letzten 50 Jahren aus dem südlichen Teil der Welt kam, der vorher das Spielfeld der Europäer war.
In gewisser Weise ist das wie Kolonialismus rückwärts.
Es ist eine Art Fortsetzung, eine Folge davon. Diese Europäer sind zu uns gekommen, um uns zu sagen, wie erbärmlich wir sind und dass sie uns eine Lektion erteilen werden. OK, wir haben gelernt: Jetzt hätten wir auch gern etwas davon. Es gibt eine Redewendung: Wir sind hier, weil ihr dort wart.
Ihre Romane beschreiben die Auswirkungen des Kolonialismus, aber Sie schreiben sie auf Englisch, der Sprache der Kolonisten.
Glauben Sie wirklich, dass Englisch die Sprache der Kolonialherren ist? Glauben Sie, dass die Sprache ihnen gehört? Zufälligerweise wurden wir von den Briten kolonisiert, wurden bis zu einem gewissen Grad in der Sprache erzogen. Diese Erziehung hat uns eine Welt des Lesens und des Verständnisses der Welt eröffnet. Benutzen wir nicht einfach die Sprache, die uns zur Verfügung steht? Derek Walcott, der karibische Dichter, schrieb über die englische Sprache: „Sie können sie mir genauso wenig wegnehmen, wie ich sie ihnen zurückgeben kann.“
Am Anfang stand der Koran, dann „Tausendundeine Nacht“
Waren Bücher aus England die ersten, die Sie als Kind beeindruckt haben?
Nein, das erste Buch, das mich beeindruckt hat, war der Koran. Damit habe ich lesen gelernt. Wir haben mit der Religionsschule angefangen, bevor wir auf die staatliche Schule gingen. Wenn Sie vor hundert Jahren in einer christlichen Gemeinde aufgewachsen wären, würden die Dinge, die Sie über die Welt zu wissen glauben, wahrscheinlich aus der christlichen Mythologie stammen. Ich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt angelangt sind, an dem wir über eine allgemeine Säkularisierung reden können. Aber es sind immer noch tief verwurzelte Geschichten, mit denen die Menschen leben. Die ersten Bücher, die ich als Kind gelesen habe, waren Dinge wie Äsops Fabeln und Tausendundeine Nacht, übersetzt in Suaheli. Auf Englisch habe ich erst mit elf oder zwölf Jahren gelesen. Und dann hauptsächlich Comics.
Sie haben „Tausendundeine Nacht“ erwähnt. Auch in Ihren Romanen gibt es Schichten über Schichten von Geschichten.
Ich denke, die Art und Weise, wie ich schreibe, funktioniert so, wie Sie sagen: Eine Geschichte wird erzählt wird, dann gibt es eine überlappende Geschichte. Das ist mein Versuch, die Bedeutung von Geschichten zu zeigen. Wie Menschen die Welt sehen, in der sie leben, wie sie sie erzählen, wie sie über sie sprechen.
Das könnte Sie auch interessieren:
In „Ferne Gestade“ gibt es zum Beispiel die Geschichte einer Mutter in der DDR, die vorher eine Farm in Kenia hatte …
… und als die Familie infolge des Zweiten Weltkrieges zurück nach Deutschland gehen muss, wird sie selbst kolonialisiert, von der Sowjetunion. Diese Geschichte erzählt auch, dass Kolonialismus nicht zwangsläufig Hautfarben kennt. Dass es Kolonialismus, wie wir es jetzt erleben, auch zwischen Europäern geben kann. Die andere Erkenntnis, zu der die Mutter durch diese Erfahrung gelangt, ist die, wie wenig sie von der Beziehung zwischen sich und den Menschen, denen sie nominell überlegen war, verstanden hat. Als sie Latifs Fuß wäscht, ist das eine Art Wiedergutmachung für das, was sie vorher nicht verstanden hatte.
Ihr neuer Roman „Afterlifes“ spielt in Tansania während der deutschen Kolonialherrschaft. Wir haben in Deutschland gerade erst begonnen, über die Kolonialgeschichte unseres Landes zu sprechen. Was können wir von der englischen Aufarbeitung des Kolonialismus lernen?
Ich glaube nicht, dass Großbritannien ein gutes Beispiel dafür ist, wie man mit einer solchen Geschichte umgeht. Wenn es hier eine längere Geschichte der Aufarbeitung gibt, dann gibt es auch eine längere Geschichte der Verschleierung und des Ausweichens vor dem, was bewältigt werden muss. Und die Vereinigten Staaten haben noch weniger darüber zu sagen: Dort bringen sie ja immer noch Menschen auf den Straßen um. Wichtig ist, dass das Bewusstsein wächst, dass es etwas gibt, mit dem man sich auseinandersetzen und das man verstehen muss.