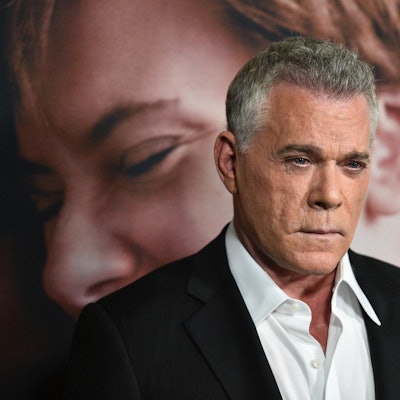Goldene Palme für Ruben ÖstlundAuch in Cannes gewinnen immer die Falschen

Cannes-Gewinner Ruben Östlund mit Sohn
Copyright: AFP
Cannes – In 75 Festivalausgaben hat das Cannes-Festival einen kleinen Club hervorgebracht, nun ist der Schwede Ruben Östlund sein neuntes Mitglied: den der Doppelgewinner. Auch wenn solche Statistiken vielleicht eher in die Welt des Leistungssports gehören. Gelungen ist das bisher nur Francis Ford Coppola (1974 und 1979), Shoei Imamura (1983 und 1997), Bille August (1988 und 1992), Emir Kusturica (1985 und 1995), Jean-Pierre and Luc Dardenne (1999 und 2005), Michael Haneke (2009 und 2012) und Ken Loach (2006 und 2016).
Östlands Farce ist amüsant, aber eher grob gestrickt
Der satirische Charakter seiner Arbeiten macht Östlund nicht unbedingt zum typischen Preisträger; 2017 hatte er mit „The Square“ die Palme zum ersten Mal überhaupt nach Schweden geholt. Waren dort seine Kritik an Klassismus und Scheinmoral noch auf den Mikrokosmos der Kunstwelt fokussiert, dreht er nun in „Triangle of Sadness“ den Zoomring seiner Kamera deutlich zurück. Die Farce über eine Luxus-Kreuzfahrt, die unfreiwillig auf einer einsamen Insel endet, rückt die Ungleichheit einer ganzen Weltordnung ins Bildfenster. Unter den Gestrandeten hat plötzlich die Toiletten-Managerin das Sagen, die als einzige weiß, wie man einen Tintenfisch aus dem Wasser zieht. Es ist eine ungemein unterhaltsame Komödie, wozu auch Iris Berben ihren Teil beiträgt. In der Nebenrolle einer sprachgestörten Schiffsreisenden erreicht sie mit einem einzigen, aber immer wieder wohl platzierten Dialogsatz eine bemerkenswerte menschliche Präsenz.
Fraglos überaus unterhaltsam, ist die Farce doch deutlich gröber gestrickt als Östlunds Vorgängerfilm. Wenn sich Woody Harrelson als marxistisch eingestellter Kapitän mit einem Oligarchen einen verbalen Schlagabtausch aus Politikerzitaten liefern, erinnern sie an Don Camillo und Peppone. Östlund kam von der Werbung zur Filmkunst, und auf deren schnelle Wirksamkeit und Deutlichkeit greift er noch immer gern zurück. Wie er uns in einem Gespräch erklärte: „Wenn man eine Idee unter die Leute bringen will, muss man erst Aufmerksamkeit finden – und dann erst kann man seine Ideen vorbringen.“
Das könnte Sie auch interessieren:
Es gab auch feinere, einfühlsamere und kunstvollere Arbeiten in diesem uneinheitlichen Wettbewerb, die schönste kam zuletzt – und ging leider leer aus. Kelly Reichardt, die große amerikanische Regisseurin, inszeniert in „Showing Up“ noch einmal die wunderbare Michelle Williams, der sie vor Jahren mit „Wendy and Lucy“ eine ihrer schönsten Rollen bot. Hier spielt sie eine Stress-geplagte Bildhauerin in Portland, die bei der Vorbereitung einer Ausstellung nach Ablenkungen nicht zu suchen braucht. Ihre Vermieterin, zu allem Ärger auch die etwas populärere Künstlerin, repariert den Warmwasserboiler nicht. Stattdessen halst sie ihr eine verletzte Taube auf, die schließlich ausgerechnet bei der Ausstellungseröffnung die fragile Terracotta-Kunst umflattert. Der allerdings drohen vielerlei Gefahren – von der tapsigen Hauskatze bis zur unberechenbaren Verwandtschaft. Wenn man so will, ist es das humanistische Gegenstück zu Östlunds Kunst-Satire „The Square“: Eine Hommage an den Normalzustand künstlerischer Arbeit, die nur wenig Geld einbringt, aber eine Menge Liebe freisetzt.

Michelle Williams in Showing Up
Copyright: Festival de Cannes
Mit leeren Händen musste Reichardt dennoch nicht aus Cannes abreisen. Der französische Regieverband verlieh ihr seine Goldene Karosse. In ihrer Dankesrede erinnerte sie sich, wie sie als Teenager von zu Hause aufbrach, um Filmemacherin zu werden. Zum Abschied schenkte ihr ihre Mutter ein Buch mit dem Bild einer Frau auf dem Einband, die eine Kamera hielt. „Vielleicht wird die Geschichte dieser Frau auch einmal die Deine sein“, hatte sie hineingeschrieben. Es war die Autobiographie von Leni Riefenstahl. „Ich habe daraus nicht wirklich gelernt, wie man Filme macht“, unterbrach Reichardt das herzliche Gelächter. „Das habe ich mir dann überall auf dem Weg aufgeschnappt und viele Gefährten dabei gefunden.“
Bis auf Iris Berben blieb das deutsche Kino außen vor
Auch in Cannes muss man immer wieder daran erinnern, dass Filmemachen, wenn etwas dabei herauskommen soll, eine intime und persönliche Angelegenheit ist. Der Wettbewerb lieferte – auch wenn insgesamt keiner der besten – dafür genug Beweise: Etwa „Close“, das bescheiden auftretende, zu Herzen gehende Drama über einen Schülerselbstmord; der erst 31-jährige Belgier Lukas Dhont erhielt dafür den Grand Prix, ex-aequo mit Veteranin Claire Denis („Stars at Noon“). Auch der polnische Altmeister Jerzy Skolimowski konnte sich freuen für seine moderne Fabel „EO“ – er bedankte sich bei jedem einzelnen der sechs Esel, die sich die Hauptrolle teilten. Den Jurypreis teilte er sich mit Charlotte Vandermeersch und Felix van Groeningen aus Belgien, die für ihr Bergdrama „Le otto montagne“ ausgezeichnet wurden. Es war ein großer Tag für das Kino unseres Nachbarlands: Für die stille Perfektion des jüngsten Werks der unfehlbaren Dardenne-Brüder gab es eine Spezialpalme, ausgelobt zum 75. Festivaljubiläum.
Das deutsche Kino steckt derweil inmitten einer künstlerischen Krise. Vielleicht könnte die dauerhafte Cannes-Abstinenz endlich zu einer dringend nötigen Debatte führen – über jenen Teil der Kunst, den Geld nicht kaufen kann.