"Mutiger geworden"„First Lady“ über Grenzerfahrungen und den Umgang mit dem Tod

Elke Büdenbender
Copyright: Hans Scherhaufer / Verlag Ullstein
- Elke Büdenbender, die Frau des Bundespräsidenten, und der Medizinprofessor Eckhard Nagel sind seit vielen Jahren befreundet. Sie kennen einander aus einer Zeit, als beide schwer krank waren.
- In einem neuen Buch, das beide gemeinsam publiziert haben, geht es um den Umgang mit Tod und Sterben als Teil des Lebens.
- Im Interview sprechen Büdenbender und Nagel auch über den Ukraine-Krieg, die Corona-Krise, den assistierten Suizid und den Bedeutungsverlust der Kirchen.
Köln – Frau Büdenbender, Herr Professor Nagel, als Sie sich für einen Gesprächsband über Tod und Sterben unterhalten haben, war in der Ukraine noch kein Krieg. Wie nahe geht Ihnen, was jetzt dort geschieht? Elke Büdenbender: Ich bin völlig entsetzt und erschüttert über das Sterben und über das Elend der Menschen, die fliehen müssen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in Europa so etwas noch einmal erleben müssen, und ich fühle mich unendlich hilflos. Krieg ist der krasseste Gegensatz zu allem, worum es uns ging, als wir uns über das Sterben Gedanken gemacht haben – im Sinne einer Integration des Todes ins Leben.
Eckhard Nagel: Es ist, als täte sich der Boden auf. Meine, unsere Generation hatte das Glück, in einem friedlichen Land mitten in einem vereinten Europa aufzuwachsen. Unsere Kinder kennen rund um Deutschland herum gar keine Grenzen mehr. Und ich war nach der friedlichen Revolution und der Wiedervereinigung überzeugter als je, dass wir kollektiv die Schrecken des Krieges auf unserem Kontinent ein für alle Mal überwunden hätten. Jetzt kommt alles wieder hoch, was wir überwunden glaubten.
Büdenbender: Mein Vater, Jahrgang 1931, und meine Mutter, Jahrgang 1937, waren Kinder des Kriegs. Ihre Erzählungen kommen mir jetzt wieder sehr stark in den Sinn, wenn ich die Bilder der fliehenden Frauen mit ihren Kindern sehe. Das gab es ja alles schon einmal. Das bricht einem das Herz.
Nagel: Zumal wir im selben Kulturkreis leben.
Kiew ist von Berlin so weit entfernt wie Rom oder Marseille.

Professor Eckhard Nagel
Copyright: Hans Scherhaufer / Verlag Ullstein
Nagel: Und es ist die gleiche Bevölkerung, die schon vom Ersten und Zweiten Weltkrieg schwer betroffen war. Mein Vater war als 20-Jähriger mit der deutschen Wehrmacht in Charkow stationiert. Daher kenne ich die Stadt – und ich höre meinen Vater noch davon erzählen, wie verloren er sich dort vorkam mit der Frage: „Was machen wir hier eigentlich?“ Jetzt, 80 Jahre später, wird dort wieder gekämpft. Und wieder werden absurde Feindbilder konstruiert. Eigentlich unvorstellbar.
Frau Büdenbender, Sie sitzen im Schloss Bellevue – dem Ort, an dem der Bundespräsident, Ihr Mann, von Amts wegen die „Macht des Wortes“ pflegt. Kommt Ihnen das vergeblich vor?
Büdenbender: Wir hatten in Europa geglaubt, wir hätten die Sprache der Waffen überwunden. Dem ist nicht so, und jetzt müssen wir sehen, wie wir Einfluss nehmen können. Ich halte das rechte Wort immer noch für das Mittel der Wahl, um dem Krieg womöglich Einhalt zu gebieten. Ob es wirkt, wird man sehen müssen. Du brauchst mit deinem Wort immer ein Gegenüber, das dir antwortet – und zwar ebenfalls mit Worten.
Wird das Nachdenken über den Umgang mit dem Tod in unserer Gesellschaft mit den Nachrichten vom Sterben im Krieg nicht auf einmal sehr relativ?
Büdenbender: Nein, das denke ich nicht.
Nagel: Wir gehen von einem Bild des Menschen aus, der wertschätzend, Geboten folgend und der Vernunft verpflichtet in einer Gesellschaft lebt. Ein Krieg wie der in der Ukraine ist unvernünftig, negiert Gebote und Grundrechte. Der Krieg als todbringende Katastrophe ist auch etwas ganz anderes als das Sterben in einer Pandemie. Das, was wir in den letzten zwei Jahren weltweit erlebt haben, ist uns als eine schicksalhafte Aufgabe gestellt, die wir bewältigen müssen, die sich aber aus der Natürlichkeit unseres Daseins ergibt – ganz im Gegensatz zu einem Krieg.
Zu den Personen
Elke Büdenbender, geb. 1962, ist Richterin. Seit 1995 ist sie mit dem heutigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier verheiratet. 2010 wurde Bündenbender eine Niere transplantiert, die ihr Mann gespendet hatte.Eckhard Nagel, geb. 1960, ist Professor für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften an der Universität Bayreuth.
Beider Familien sind seit vielen Jahren miteinander befreundet.
Ihr gemeinsames Buch „Der Tod ist mir nicht unvertraut. Ein Gespräch über das Leben und das Sterben“ ist im Verlag Ullstein erschienen. (jf)
Ist die Gesellschaft mit dieser Aufgabe in der Pandemie nicht auch schon an Grenzen gestoßen? Denken Sie daran, wie viele Menschen in Krankenhäusern oder Pflegeheimen beim Sterben allein gelassen werden mussten – lange, ohne dass das in Frage gestellt wurde.
Büdenbender: Es führt uns zwar nicht weiter, die Maßnahmen am Beginn der Pandemie mit unserem heutigen – besseren – Wissen zu kritisieren. Es zeichnete die Pandemie ja gerade aus, dass man zunächst nicht wusste, wie man ihr begegnen soll und was gegen das Virus hilft. Wir müssen aber aus den seitdem gesammelten Erfahrungen lernen und dann auch fragen: Was hätten wir besser anders gemacht? Denn wir müssen schon auch feststellen, welch tiefe Wunden die Pandemie geschlagen hat. In einem Gespräch hat es ein Bestatter auf den Punkt gebracht: „Ich hatte Menschen bei mir sitzen, die haben einen Angehörigen ins Krankenhaus gebracht und einen verschlossenen Sarg zurückbekommen.“
Eine traumatisierende Erfahrung.
Büdenbender: Mein Mann hat in der Gedenkfeier für die Verstorbenen versucht, darauf aufmerksam zu machen und dafür zu sensibilisieren, dass wir dieses Leid der Menschen anerkennen und das Geschehene aufarbeiten.
War die Gedenkfeier auch ein Angebot „von Staats wegen“ an die Menschen, die keiner Konfession mehr angehören und für die Gottesdienste keine passende Form des Trostes und der Bewältigung von Leid wahrnehmen?
Büdenbender: Als Bundespräsident ist mein Mann für alle da – Religiöse und Nicht-Religiöse, kirchlich Gebundene und Säkulare. Deswegen fand ich es ganz, ganz wichtig und richtig, beides zu verbinden: Gottesdienst und weltliches Gedenken – mit der Möglichkeit, dass Menschen stellvertretend davon berichten konnten, wie es ihnen dem Tod von Angehörigen und dem Leiden an diesem Verlust ergangen ist.

Eckhard Nagel und Elke Büdenbender
Copyright: Hans Scherhaufer / Verlag Ullstein
Nagel: Es braucht verschiedene Sprachen und Formen, einem kollektiven Trauma den angemessenen Raum zu geben. Auch unser Dialog ist ein Versuch. Mit Blick auf die Pandemie bleibt festzuhalten, dass diese mit einer großen Zahl lebensbedrohlicher Erkrankungen unsere Gesellschaft aufgerüttelt hat. Dabei wurden vielfältige Mängel aufgezeigt und das Streben nach Unterstützung in der Gesundheitsversorgung deutlich artikuliert. Nun gilt es als unser zentrales Anliegen dafür zu werben, das Sterben in das Leben auch ganz praktisch zu integrieren.
Der Tod Ihres Vaters, Frau Büdenbender, fiel in die Zeit mit Corona-Auflagen und Versammlungsbeschränkungen. Wie haben Sie das erlebt?
Büdenbender: Wir hatten es leichter als andere. Als mein Vater starb, gingen die Corona-Zahlen gerade zurück. In unserer sehr großen Dorfkirche konnten wir mit immerhin 60 Menschen die Totenmesse feiern und uns an den Tagen zuvor auch zu den Totengebeten versammeln. Aber natürlich: Wir durften nicht singen, und wir mussten so vieles bedenken, was gar nicht dem natürlichen Impuls beim Tod eines lieben Menschen entspricht – einfach nur trauern zu dürfen. Listen schreiben, Abstand halten, Verzicht auf die Kondolenz am Grab und auf den Beerdigungskaffee, wo dann ja auch Erinnerungen geteilt werden und miteinander gelacht werden darf. Solche Rituale, die ja auch heilsam sind, waren alle nicht möglich, und das verstärkt die Trauer. Das hört sich jetzt vielleicht nicht sonderlich schlimm an. Aber es war schon eine sehr, sehr merkwürdige und auch schmerzvolle Erfahrung, die mir zeigt, was Corona uns auch genommen hat.
Was folgt daraus für Sie?
Büdenbender: Ich plädiere dafür, dass die Menschen sich mitten im Leben mit ihren Lieben darüber verständigen, wie sie es denn irgendwann einmal mit dem Sterben halten wollen. Mein Mann und ich zum Beispiel haben eine Patientenverfügung und darüber natürlich ausführlich miteinander gesprochen. Wenn ich für den Todesfall vorsorge, ist das ja auch ein Stück Fürsorge für meine Nächsten.
Nagel: Im interreligiösen und interkulturellen Dialog, den wir im Deutschen Evangelischen Kirchentag pflegen, ist mir aufgefallen, dass wir viel über unsere Menschenbilder, Gottesdienste oder auch uns über unser Gesellschaftsverständnis austauschen. Aber Tod und Trauer bleiben hier ziemlich ausgespart. Ich bin im Dialog-Kontext noch nie zu einer muslimischen oder jüdischen Trauerfeier eingeladen worden. Dabei wäre es in einer zunehmend pluralen Gesellschaft so wichtig, Formen der Trauer und des Abschieds kennenzulernen und zu verstehen, wie sie jenseits der eigenen Tradition gepflegt werden. Wir halten das für eine erheblich vertane Chance. Tod und Verlust sind – unabhängig von jeder kulturellen Prägung – doch zunächst einmal urmenschliche Erfahrungen, die uns allen gemeinsam sind. Daraus könnte doch ein Fundament gegenseitigen Verstehens und Wertschätzens werden.
Frau Büdenbender, Sie sagten eben, Sie plädierten für einen Austausch über das Sterben. Aber Sie praktizieren das ja auch, indem Sie etwa sehr offen über eigene Grenzerfahrungen sprechen. Sie waren Dialysepatientin, haben von Ihrem Mann eine Spenderniere erhalten. Wenn Sie vor diesem Hintergrund den Satz sagen, „wie du lebst, so stirbst du auch“, was meinen Sie damit?
Büdenbender: Diese Grenzerfahrungen beeinflussen sehr stark, wie ich heute auf das Leben schaue. Wenn ich irgendwann einmal im Einklang und im Frieden mit mir selbst gehen möchte, dann kann ich das nur, wenn ich mir zuvor schon darüber Gedanken gemacht habe. Und genau deshalb geht es, wenn ich über den Tod nachdenke und spreche, zuerst und vor allem um das Leben. Ich glaube, dass ich mit meinen Erfahrungen sehr viel bewusster lebe und meine Entscheidungen sehr viel bewusster treffe. Ich weiß genauer, was mir wirklich wichtig ist – oder jedenfalls hoffe ich das. Und ich bemühe mich, das dann auch in die Tat umzusetzen.
Ein Freund hat mir nach überstandener Krebserkrankung gesagt: Ich habe vor nichts mehr Angst. Kennen Sie das auch?
Büdenbender: Das könnte ich für mich so nicht sagen. Ich bin schon noch sehr verletzlich – gerade, was die Sorge um meine Nächsten angeht: meinen Mann, unsere Tochter, die Familie. Weil ich weiß, was mir verloren ginge. Für mich selbst würde ich sagen: Ich bin mutiger geworden. Ich kann eher mal mein Herz über die Hürde werfen und zu mir selber sagen: Du weißt nicht, ob das jetzt wirklich alles so klappt, aber mach’s einfach! Schon damit du dir hinterher nicht vorwerfen musst, du hättest es nicht mal versucht.
Nagel: Aus Sicht des Mediziners bewahrheitet sich hier der Satz, die Krankheit als Chance zu verstehen. Sich der eigenen Endlichkeit bewusst zu werden, gibt dem Leben eine andere Orientierung. Die Grenzerfahrung einer Krankheit ist dann eben keine Eingrenzung, sondern eine Erweiterung des Lebens.
An der Grenze zum Tod treten Sie, Frau Büdenbender, für die Möglichkeit des assistierten Suizids ein. Sie, Herr Nagel, sehen das anders. Warum?
Büdenbender: Ich teile die Auffassung des Bundesverfassungsgerichts, das den Paragrafen 217 mit dem Verbot des geschäftsmäßigen assistierten Suizids beanstandet hat.
Warum?
Büdenbender: Weil ich glaube, dass es der Selbstbestimmung des Menschen widerspräche, wenn ihm die Inanspruchnahme fachkundiger Hilfe zum Suizid gänzlich verboten wäre.
Nagel: Mir geht es um das Signal, das der vom Bundesverfassungsgericht verworfene Paragraf 217 gesetzt hatte: Das Leben des Menschen ist unverfügbar. Ich zucke zusammen, wenn ich im Beschluss des Gerichts lese, es soll für jeden, der das will, ein Anrecht auf Hilfe bei der Beendigung des eigenen Lebens geben. Der Gedanke, dass es künftig in jeder deutschen Stadt Anlaufstellen für Lebensmüde geben sollte, widerspricht fundamental meinem Bild von einer humanen Gesellschaft. Und ich zucke noch einmal zusammen, wenn ich das Wort „geschäftsmäßig“ höre. Die Selbsttötung darf nicht in eine Logik der Ökonomisierung geraten.
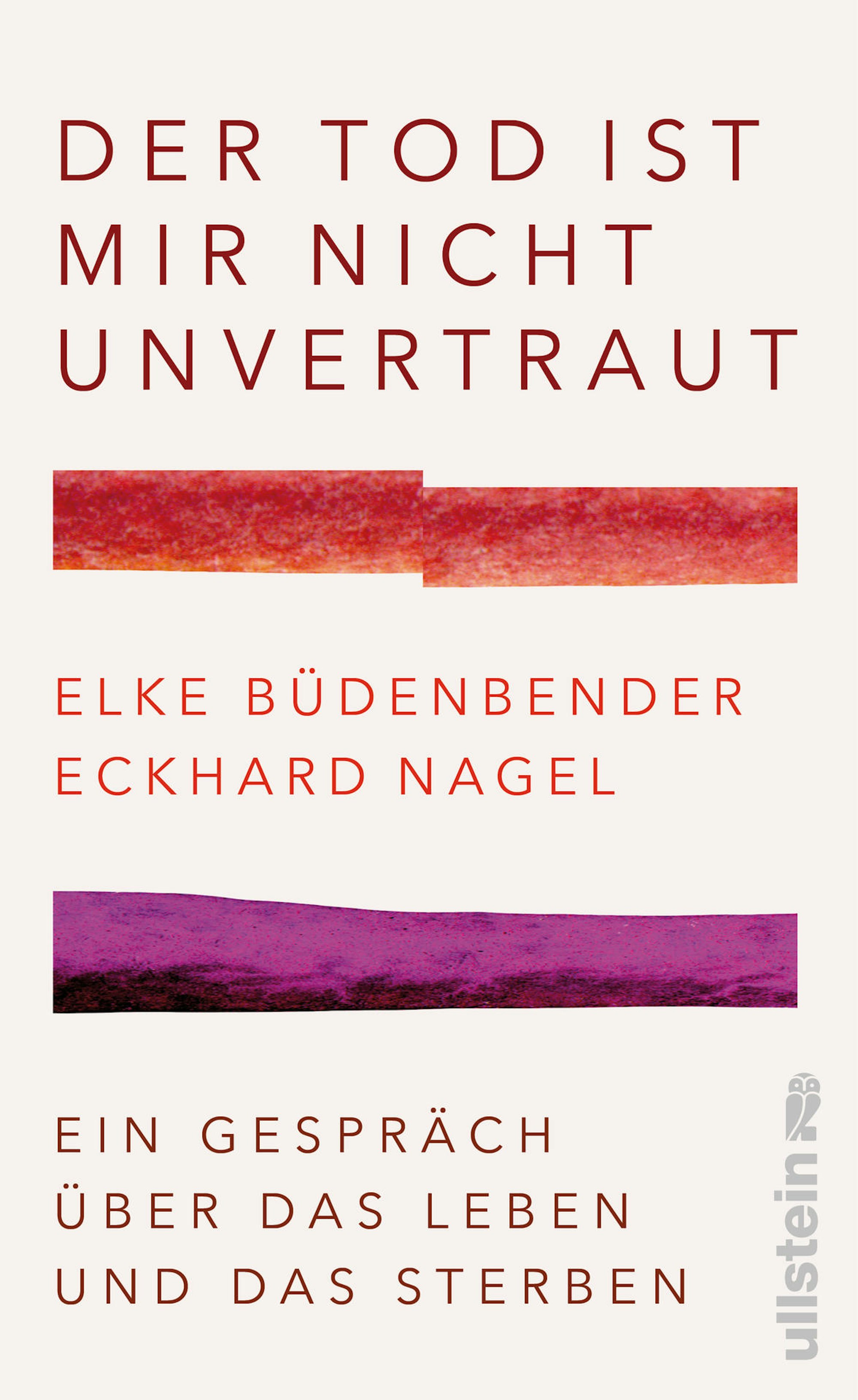
Buchcover
Copyright: Verlag Ullstein
Büdenbender: „Geschäftsmäßig“ heißt ja nicht „kommerziell“, sondern nur, dass es um ein wiederholtes Angebot handelt. Aber auch das kann eine Gefahr sein, wenn der freie Wille von Menschen manipuliert wird. Ganz sicher muss eine gesetzliche Regelung verhindern, dass Menschen den Suizid wählen, zum Beispiel um niemandem „zur Last zu fallen“. Der Gesetzgeber muss die Balance zwischen dem Selbstbestimmungsrecht und dem Schutz des Lebens halten.
Nagel: Und er darf ein wie auch immer gesetzlich geregeltes Angebot zum assistierten Suizid auf gar keinen Fall der Ärzteschaft aufbürden.
Warum nicht?
Nagel: Auch da geht es um ein Signal. Wer zum Arzt geht, muss wissen: Egal, was passiert, mein Leben steht nicht zur Disposition. Es gehört nicht zum ärztlichen Behandlungsauftrag, jemandem bei der Selbsttötung zu helfen. Im Gegenteil: Als Berufsgruppe hat die Ärzteschaft im Nationalsozialismus mit der Beihilfe zu ungeheuren Verbrechen so große Schuld auf sich geladen, dass sie sich denkbar weit von jeder Form der Beteiligung am Tod von Menschen fernhalten sollte.
Aber die Zeiten ändern sich, genau wie die ärztlichen Aufgaben. Die Palliativmedizin zum Beispiel ist auch erst vor 20, 30 Jahren dazugekommen.
Nagel: Dafür bin ich ja auch dankbar. Aber Sterbebegleitung ist prinzipiell etwas anderes als Begleitung der Tötung. Dazwischen steht eine für mich unverrückbare Hürde. Im Zweifel stehen Ärzte für das Leben. Und wenn jemand für sich selbst am Leben zweifelt, muss es eine Profession geben, die ohne Wenn und Aber für das Leben wirbt.
Nur wer sollte denn mit der Suizidassistenz betraut werden, wenn nicht Ärztinnen und Ärzte?
Nagel: Es gibt in unserer Profession keine eigenen Kenntnisse und keine Ausbildung, wie man jemandem beim Sterben hilft.
Der Hausarzt, die Hausärztin, die ihre Patienten am besten kennen, sollten ihnen in ihrem Todeswunsch nicht beistehen dürfen?
Nagel: Ich habe in meinen 30 Jahren als Arzt keinen einzigen Patienten erlebt, dem ich am Ende beim Suizid hätte helfen sollen. Wann immer ich danach gefragt wurde, haben sich andere Wege aufgetan. Diese persönliche Erfahrung untermauert die These, dass sich mit persönlicher Zuwendung der Wunsch nach Selbsttötung weitestgehend auflöst.
Büdenbender: So weit entfernt voneinander sind wir beide aber am Ende gar nicht. Die Selbstbestimmtheit am Ende des Lebens, die das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum Paragrafen 217 mit dem Verbot des geschäftsmäßigen assistierten Suizids sehr stark betont, halten wir gemeinsam für einen hohen Wert. Der Mensch hat ein Recht, darüber zu entscheiden, wann und wie er gehen möchte. Es muss ihm erlaubt sein, aus freien Stücken zu gehen – aber erst wenn er seinen Willen wirklich autonom gebildet, das Für und Wider abgewogen hat, so wie das Bundesverfassungsgericht es auch deutlich dargelegt hat. Und damit darf niemand allein bleiben. Denn das ist mir auch aus den Gesprächen mit Eckhard Nagel sehr deutlich geworden: So wie wir wesentlich in Beziehungen leben, sollte auch das Sterben keine beziehungslose Angelegenheit sein.
Der schärfste Widerspruch gegen das Karlsruher Urteil zur Ermöglichung des assistierten Suizids kam von der katholischen Kirche, Frau Büdenbender. Hadern Sie deshalb mit Ihrer Kirche?
Büdenbender: Ich hadere an einer ganzen Reihe von Punkten mit ihr. In diesem Fall ist mir schon klar, dass meine Auffassung im Widerspruch zur kirchlichen Position steht. Aber ich sehe mich gleichwohl als Teil der Kirche, auch wenn ich nicht in allem mit ihr übereinstimme. Ich akzeptiere natürlich den Standpunkt, das Leben als Geschenk Gottes sei der Verfügung des Menschen entzogen. Aber als Juristin sehe ich das eben auch noch unter einem anderen, verfassungsrechtlichen Aspekt.
Gehört zum Wesen des Geschenks nicht, dass der Beschenkte frei damit umgehen kann?
Büdenbender: Genau das ist jetzt eher juristisch gedacht, nicht theologisch oder spirituell. Ich teile die Sicht vom Leben als Geschenk, weil ich ja tatsächlich nichts dafür getan habe, dass ich am Leben bin. Aber ich unterstütze die Position des Bundesverfassungsgerichts, dass zur Verantwortung für das eigene Tun und Lassen, die ich an niemanden anderen delegieren kann, auch die Selbstbestimmung, so wie das Bundesverfassungsgericht sie ausbuchstabiert hat, über meinen Tod gehört.
Nagel: Es verläuft ein schmaler Grat zwischen Selbstbestimmung und Mitmenschlichkeit. Auch die Kirchen wollen mit ihrer Ablehnung des assistierten Suizids ja niemanden allein lassen – im Gegenteil. Sie halten es für einen Ausdruck von Mitmenschlichkeit, das Leben nicht zur Disposition zu stellen. Und selbst wenn man die Autonomie des Menschen auch mit Blick auf einen Todeswunsch anerkennt, kann man dennoch die Frage stellen, ob eine etwaige Assistenz dann in ihrer Mitmenschlichkeit nicht einzig und allein auf eine Revision dieses Wunsches gerichtet sein muss. Zumal dieser Wunsch, einmal realisiert, nun per Definition unwiderruflich ist.
Kommen wir zurück auf das Hadern mit Ihrer Kirche, Frau Büdenbender. Sie beklagen auch, dass die Kirchen zunehmend als Instanzen ausfallen, die am Ende des Lebens, im Umgang mit Tod und Trauer Halt geben.
Büdenbender: Ich persönlich bin und bleibe ein gläubiger Mensch. Gerade in der Trauerbegleitung habe ich mit Vertretern meiner Kirche, der katholischen Kirche, auch viele gute Erfahrungen gemacht. Generell hat sich unsere Gesellschaft aber mit der voranschreitenden Säkularisierung und dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt von religiösen spirituellen Bedürfnissen entfernt. Der Satz „Wir haben an Lebenszeit gewonnen und die Ewigkeit verloren“ hat viel Wahres. Nur ist es die Frage, ob die Kirchen mit ihrer Botschaft, ihrer spirituellen Praxis, auch mit ihren Ritualen noch ein Angebot haben, das den inneren Bedürfnissen der Menschen ausreichend nahe kommt.
Das könnte Sie auch interessieren:
Nagel: Ich möchte daran erinnern, dass christliche Glaubensüberzeugungen implizit an vielen Stellen unserer Gesellschaft vorkommen und lebendig sind. Ich war erst kürzlich mit Maltesern und Johannitern beim Aufbau von Flüchtlingsunterkünften unterwegs, und ich war fasziniert von einem professionellen Engagement, das seinen Grund im christlichen Menschenbild und im christlichen Glauben hat. Die Kirche als Institution tut sich demgegenüber gerade schwer, keine Frage.
Büdenbender: Auch ich habe mit vielen ehrenamtlich engagierten Christinnen und Christen zu tun, insbesondere auch jungen. Sie leiden – wie auch ich selbst – daran, wie unsere Kirche, und damit meine ich jetzt die katholische Kirche, mit den Menschen umgeht, die durch sexuellen Missbrauch im Raum der Kirche so schlimm verletzt wurden. Das ist ganz, ganz fürchterlich – in erster Linie natürlich für die Betroffenen. Das überlagert in der öffentlichen Wahrnehmung alles, was die Kirche sonst an Gutem tut. Aber das ist auch richtig, solange die Kirche keine zureichenden Antworten auf den Skandal des Missbrauchs findet.
Warum sind Sie selbst noch in der Kirche?
Büdenbender: Vor allem auch aus einer tiefen geistigen Verbundenheit mit meiner Mutter und meiner Großmutter, die keine unkritischen Katholikinnen waren. Ich denke, es gibt nach wie vor viele tolle Menschen, die zu dieser Kirche gehören und in ihr wirken. Die Laien sind der große Schatz der katholischen Kirche.
Nagel: Meine Kirche steht hier nicht viel besser da. Ich meine dennoch, man sollte immer zwischen der Institution und der Gemeinschaft der Glaubenden unterscheiden. Ich bin in meiner Gemeinde fest verankert, die mir als spirituelle Heimat und Rückzugsraum sehr wichtig ist.



