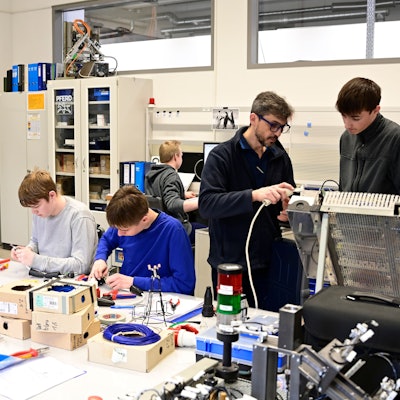Wo endet die humanitäre Hilfe und beginnt die militärische Unterstützung? Und was darf oder sollte man als Christ beitragen? Über diese Fragen sprach Reiner Thies mit dem Aktivisten Manuel Weber.
InterviewDer Reichshofer Manuel Weber bringt Armeehilfsgüter in die Ukraine

Der ukrainische Pfarrer Sasha Koropets (r.) überreichte Manuel Weber zum Dank die signierte Flagge einer Armeeeinheit.
Copyright: Manuel Weber
Haben Sie in der Ukraine Angst um Ihr Leben?
Nein. Ich benutzte zwar die Warn-App, die anzeigt, wenn in Russland oder Belarus ein Flugobjekt Richtung Ukraine startet, aber achte inzwischen kaum noch darauf. Das Land ist riesengroß, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Rakete in meiner Nähe einschlägt, äußerst gering. Im Westen des Landes versuchen die Leute, ihr normales Leben zu führen. Es gibt viel weniger Checkpoints der Armee, die Atmosphäre ist nicht mehr so angespannt. Beim nächsten Transport werde ich wahrscheinlich weiter nach Osten vordringen. Sie sind Vater von vier Kindern.
Was sagt Ihre Familie?
Die Kinder sind stolz darauf, was ihr Vater für die Ukraine macht. Meine Frau weiß, dass ich fahren muss, und räumt mir diese Freiheit ein. Warum gehen Sie das Risiko ein? Je häufiger ich mich mit den Menschen in der Ukraine unterhalte, desto mehr verstehe ich von der Situation und fühle mit ihnen. Die Leute kämpfen nicht zum Spaß, sondern dafür, ihren Glauben praktizieren und frei wählen zu können. Sie setzen ihr Leben für etwas ein, was uns selbstverständlich ist. Das ist kein Konflikt um Territorium oder Rohstoffe. Das Land verteidigt seine Werte.
Ist bei Ihnen auch ein bisschen Abenteuerlust dabei?
Am Anfang ging es mir vielleicht auch ein bisschen darum, mir das alles einmal aus der Nähe anzuschauen. Aber nachdem ich die Menschen an der Grenze das erste Mal getroffen und ihre Geschichten gehört habe, ist es das Mitgefühl, was mich antreibt. Und die Erfahrung, dass ich tatsächlich helfen kann. Sie rüsten mit den Hilfsgütern auch ukrainische Soldaten aus.
Wie stehen Sie als Christ zu den Hilfslieferungen?
Man muss sich vor Augen führen, dass diese Leute keine gut ausgerüsteten Rambos sind. Es sind Söhne, Töchter, Ehepartner und Geschwister. Sie stecken oft seit Monaten in derselben Uniform und denselben Stiefeln und essen verfaulte Kartoffeln. Wir liefern keine Panzerfäuste, sondern Gummistiefel. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Einst haben Sie den Wehrdienst verweigert.
Konnten Sie sich damals vorstellen, in dieser Weise in einen Krieg involviert zu sein?
Nein, gar nicht. Krieg war total abstrakt, so etwas kannte ich nur aus Hollywood-Filmen. Ich war naiv, im vergangenen Jahr habe ich viel gelernt, mein Denken hat sich geändert. Vor zwei Jahren hätte ich bestimmt gesagt, dass ich ein Pazifist bin. Das kann ich heute nicht mehr.
Gibt es in der Kirchengemeinde Diskussionen mit Gemeindemitgliedern, die die Ukraine-Hilfe nicht mit ihrem christlichen Glauben vereinbaren können?
In meiner eigenen Gemeinde spielt das keine große Rolle. Aber es gibt andere Gemeinden, die sich aus der Hilfsaktion zurückgezogen haben, als sie gehört haben, dass wir Güter auch an das Militär ausliefern. Aber das muss man respektieren. Es handelt sich oft um Russlanddeutsche, die emotional zerrissen sind.
Warum haben Sie das Projekt „Lebensretter“ ins Leben gerufen?
Das ist eine finanzielle Frage. Unsere kleine Gemeinde wäre überfordert, da wir ja nun auch Geld für Transportfahrzeuge sammeln, da geht es dann um größere Summen.
Wie erleben Sie die Menschen in der Ukraine?
Fast die Hälfte der Bevölkerung hat das Land verlassen. Viele Männer sitzen allein zu Hause. So etwas hinterlässt Spuren in einer Gesellschaft. Manche gehen ihrer Arbeit nach. Aber diejenigen, die mit den Hilfstransporten in den Osten zu tun haben, sind ziemlich fertig.
Wie lange halten Sie selbst das noch durch? Wie lange wird dieser Krieg noch dauern?
Darüber darf ich nicht nachdenken. Natürlich ist das enorm anstrengend, erst recht, wenn man ja noch Familie und einen Job hat. Die Ukraine gewinnt gerade Land dazu. Der Krieg könnte bis Ende des Jahres zu Ende gehen. Aber am Ende hängt es eben davon ab, wann Putin die Luft ausgeht.