Tinder und Co.Zerstört Online-Dating die Romantik?
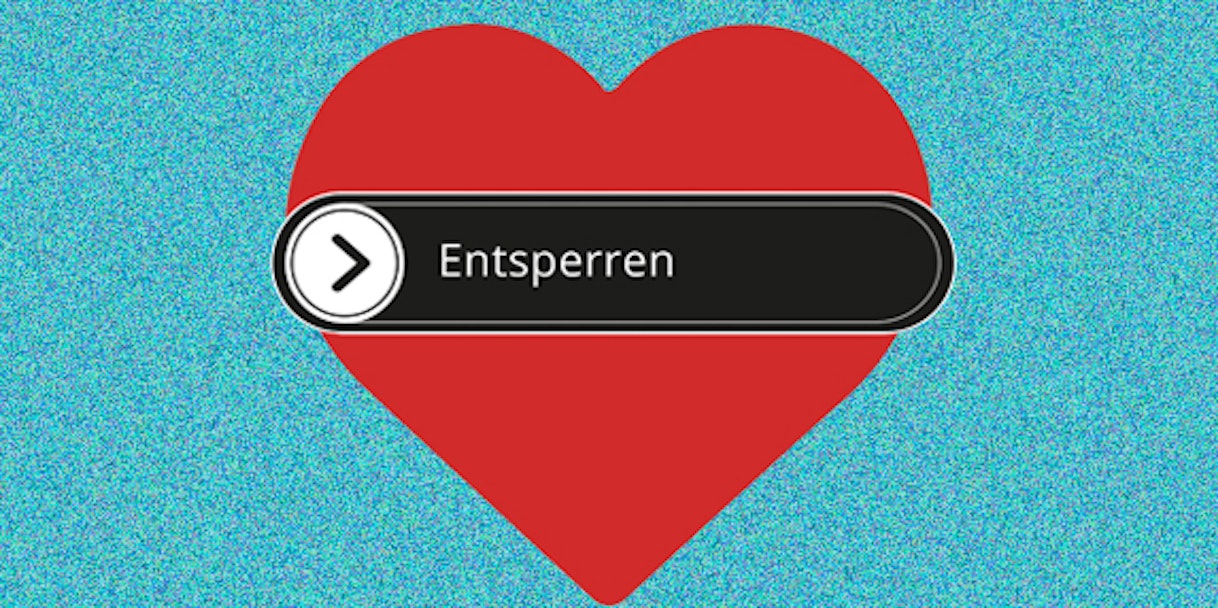
Copyright: KSTA
- Jede Woche widmen wir uns einer Streitfrage und stellen ein Pro und ein Contra vor. In dieser Folge: Zerstört Online-Dating die Romantik?
- Jonah Lemm (23), Redakteur im Ressort NRW/Story, hat auch mal einen Tinder-Account besessen, seine Freundin dann aber ganz analog in der Universität kennengelernt.
- Nadja Lissok (28), Volontärin, schaut von allen verkitschten Liebesfilmen am liebsten „Notting Hill“. Zumindest lernen sich die beiden im Buchladen kennen – und verschütten erst dann ein Getränk.
Ein Drittel der Deutschen sucht die Liebe im Internet. Das Versprechen: effiziente Partnersuche mit Algorithmen. Macht die Technik die Beziehungssuche besser oder nur unromantischer?
Pro: Algorithmen können keine Sympathie nachahmen
Es ist nicht lang her, da hat es eine Freundin mit Tinder versucht. Tinder, das sei für alle Glücklich-Langzeit-Vergebenen und Smartphonelosen erklärt, ist eine Dating-App, in der es vorrangig ums Aussehen geht. Man sieht ein Bild, einen Namen, der wahrscheinlich echt ist, sicher aber kein Sofort-Abtörn-Pseudonym wie Blaubeerchen82, dazu eine kurze Selbstbeschreibung. Dann muss man sich entscheiden: Wischt man auf dem Handy nach links, hat man kein Interesse, nach rechts, dann schon. Hat die andere Person auch nach rechts gewischt, darf man miteinander schreiben.
Die Freundin, eine sehr kluge Studentin, tinderte los, lernte einen Mann kennen, den sie ganz okay fand. Und warum nicht mal probieren? Man verabredete sich zum Picknick. Nachdem der Mann die Freundin zwecks Spontanitätsprüfung zu einem Tanz mitten im Park aufgefordert hatte, was die Freundin sehr unangenehm fand, stellte sich heraus, dass der Mann nicht wirklich eine Cateringagentur betrieb wie angegeben. Sondern aushilfsweise als Kellner jobbte. Eigentlich, sagte er, wollte er mal zur Polizei, war aber durchs Auswahlverfahren gefallen, weil bei „irgendeiner Aufgabe mit so Formen“ herauskam, dass er zu blöd sei. Er meinte wohl einen IQ-Test. Zum Schluss eröffnete der Mann der Freundin, er sei sowieso nur auf der Suche nach schnellem Geschlechtsverkehr. Wobei er sich dabei nicht ganz so gewählt ausdrückte. Aus den beiden wurde dann nichts.
Was meinen Sie? Sagen Sie uns Ihre Meinung!
Schreiben:Kölner Stadt-Anzeiger, 50590 KölnFaxen:02 21/2 24-25 24Mailen:leserforum@dumont.de
(Bitte alle Schreiben, Mails, Faxe und Online-Zusendungen mit kompletter Anschrift)
Das also soll die neue Bequemlichkeit im Dating sein, die Tinder und ähnliche Angebote versprechen? Die Befreiung des Kennenlernens von der Peinlichkeit? Denn so geht ja die Logik des Online-Datings: Nie wieder Nervosität und Abfuhren. Der unangenehmste aller Schritte, der erste, wird ersetzt durch unpersönliche Klicks. Keiner muss mehr in einer überfüllten Bar unbeholfene Gesprächseinstiege in fremde Ohren poltern. Scham wird gespart. Und Zeit. Tindern, das geht auch beim Frühstück, in der Mittagspause, am Schreibtisch. Wem andere Dinge wichtiger sind als Aussehen, der kann seine Suche spezifizieren, etwa auf Portalen für Hundebesitzer, für große Menschen, für Harry-Potter-Fans. Nur können Algorithmen keine Sympathie nachahmen.
Und so kommt die Peinlichkeit zurück, potenziert um ein hundertfaches im Ich-will-bloß-hier-weg-Faktor. Hätte die Freundin im echten Leben nur drei Sekunden mit dem hyperkoitalen Fast-Polizisten gesprochen, sie hätte ihn nie wieder sehen wollen. So aber musste sie gleich eine ganze Reihe unangenehmer Situationen durchstehen. Statt der Mühe, die man sich mal machte, um jemanden kennenzulernen, macht man sich nun die Mühe, herauszufinden, wen man doch lieber nicht kennengelernt hätte.
Das könnte Sie auch interessieren:
Es entsteht eine paradoxe Reaktion: Die Einsamkeit verringert sich durchs Online-Dating nicht. Sie wird noch größer. Singles mit Niveau? Pah! Singles mit zukünftigen Minderwertigkeitsgefühlen. Die Ausrede, da draußen ist schon jemand, man hat ihn nur noch nicht gefunden, gilt nicht mehr. Das Internet findet sofort hunderte potenzielle Partner. Wenn davon dann aber keiner passt, kommt das Gefühl auf, selbst ein gesellschaftsinkompatibler Klops zu sein. Vielleicht liegt es an mir? Diese Frage hinterlässt Macken. Aber die sieht man auf dem photogeshoppten Profilbild natürlich nicht.
Contra: Schlechte Dates gab es auch schon vor dem WWW
Kennen Sie diese überdrehten Liebeskomödien, die damit beginnen, dass ein Mann in eine Frau reinstolpert und ihr seinen Kaffee über die Bluse schüttet? Oder ihr aus Versehen das Portemonnaie aus der Hand schlägt und das Kleingeld runterfällt, das die beiden dann zusammen aufsammeln. Oder zwei sehr gestresste, sehr schöne Menschen streiten sich im Flugzeug um den Platz am Fenster und stellen 90 Minuten später fest, dass sie sich lieben. Die Paarungen: Der liebenswerte Trottel (männlich, bis etwa 2010 gespielt von Hugh Grant) und die überempfindliche Ziege (weiblich, dünn) oder – umgekehrt – das Arschloch und die Sensible. Wenn es am Ende des Films ein glückliches Paar gibt, heißt das im Fachjargon „romantisch“.
Im Internet beginnen diese Hollywood-Geschichten nie. Weil Dating-Seiten das Image anhaftet, dass sich dort nur die hässlichen Verzweifelten tummeln. Oder die, die auf schnellen Sex aus sind. Noch schlimmer: Diejenigen, die die Suche nach einer Beziehung praktisch angehen. Die Unromantischen. Denn mathematisch ist es einfach: Online-Dating erweitert den Kreis potenzieller Partner. Mehr Auswahl bei gleichzeitig besserem Überblick. Die Suche ist effektiver, wichtige Fakten wie Wohnort, Beruf und Alter filtert der Algorithmus. Wer einen möglicherweise Seelenverwandten in der Straßenbahn sieht, muss erst einmal umständlich herauszufinden, ob dieser „verfügbar“ ist – und wer macht sich schon die Mühe?
Jede dritte heterosexuelle Ehe nimmt im Internet seinen Anfang, zeigt eine Studie in den USA, homosexuelle Paare finden sich schon zu 70 Prozent online. Die Forschung ergibt, dass die Beziehungen dieser Paare länger halten und alle Beteiligten zufriedener machen. Sich online kennenzulernen, macht Beziehungen also besser. Denn was viele vergessen: Man bandelt zwar von der Couch aus in der Jogginghose an, entscheidet blitzschnell, ob man auf Tinder nach rechts oder nach links wischt, doch sich treffen funktioniert noch ganz klassisch. Einer fragt, der andere willigt ein, die beiden verabreden sich und sehen sich zum ersten Mal. Dann passiert vielleicht etwas Schönes: der Puls geht minimal schneller, die Gesten werden größer, das Grinsen breiter. Man mag sich. Das Offline-Gefühl bleibt gleich. Oder man mag sich eben nicht. Und schlechte Dates gab es auch schon vor dem WWW.
Eigentlich müsste Online-Dating Online-Kennenlernen heißen. Denn dort stellen sich zwei Menschen einander vor, die sich nach dem Abtasten gewisser Grundparameter (Was sucht der andere? Hat man sich etwas zu erzählen?) einigen, sich zu treffen. Nur ohne den vermeintlich magischen Kennenlern-Moment, der sich, um auf Hugh Grant zurückzukommen, in der Rückschau romantisch verklären lässt. Klappt übrigens auch nur solange die Beziehung glücklich ist. Dieser vermeintliche Schlüsselmoment lässt sich im Nachhinein auch gern zum Warnsignal umdeuten. War der Streit um den Sitzplatz schon der erste von vielen? Vom Ende her gedacht. Oder bleibt irrelevant. Dann wäre die Begegnung nicht der Anfang einer gemeinsamen Geschichte, sondern nur eine Situation, in der zwei Menschen zusammen Kleingeld aufklauben.



