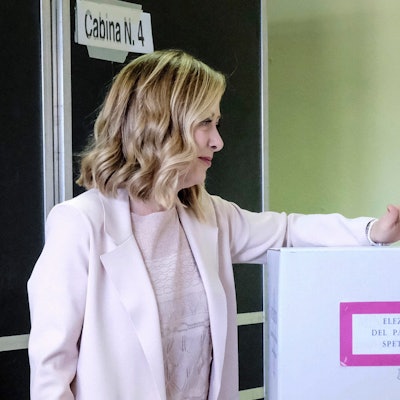Wie passen Popkultur und Populismus zusammen? „Popkultur ist oft eher politisch progressiv, aber keineswegs immer,“ erklärt Mario Anastasiadis.
Parolen zu Partysongs„In der Popkultur resoniert auch rechtsextremes Gedankengut“

Nach dem Rassismus-Eklat auf Sylt haben Gruppen in Westerland zu Demonstrationen aufgerufen (Archivbild).
Copyright: dpa
Erst grölen junge Feiernde fremdenfeindliche Parolen zu einem Partyhit, dann wird die AfD in den Europawahlen zweitstärkste Partei bei den unter 25-Jährigen. Das Ergebnis eines Zusammenspiels von Popkultur und Populismus? Ein Poptheoretiker gibt Antworten.
Herr Anastasiadis, an Pfingsten wurden in einer Sylter Disco rassistische Parolen zum Partysong l‘amour toujours gegrölt. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie das Video gesehen haben?
Mario Anastasiadis: Ich hatte einen doppelten Eindruck: Zum einen ist es natürlich geschmacklos und politisch abstoßend. Zum anderen aber auch nicht weiter verwunderlich. Denn wir wissen, dass in allen Milieus rechtsextremes Gedankengut vorherrscht. Und wenn es sich in den sozialen Medien in aller Sichtbarkeit bahnbricht, ist das zwar höchst unerfreulich, jedoch keine Überraschung.
Zur Person
Dr. Mario Anastasiadis ist Kommunikations- und Medienwissenschaftler an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg sowie Sprecher der AG „Populärkultur und Medien“ innerhalb der Gesellschaft für Medienwissenschaft (GfM)
Einige Kommentatoren, darunter der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein, begreifen den Vorfall als Phänomen der Popkultur. Stimmen Sie dem als Poptheoretiker zu?
Ja, und es muss einem nicht immer gefallen, was Popkultur hervorbringt. Popkultur ist oft eher politisch progressiv, aber keineswegs immer. Als Resonanzraum der Gesellschaft ist sie oft auch provokativ, manchmal sogar gesetzesbrecherisch und antiliberal. Es gibt Rechtsrock, rechten Hip-Hop und vieles mehr und all das war immer schon integraler Bestandteil der Popkultur.
Nun wurde die AfD bei der Europawahl von rund 16 Prozent der unter 25-Jährigen gewählt. Bietet die Verbindung von Popkultur und rechtsextremem Populismus hierfür eine Erklärung?
Inwiefern etwa wirtschaftliche Faktoren, der familiäre Hintergrund oder das Verhalten der Peergroups für die Wahlentscheidung der jungen Bevölkerung ausschlaggebend war, und welche Rolle dabei popkulturelle Faktoren konkret gespielt haben, ist eine hochkomplexe Frage und zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher zu beantworten. Dies muss analytisch in Ruhe betrachtet werden.
Wichtig wäre aber zunächst, zu klären, was in diesem Zusammenhang mit Popkultur gemeint ist. Ist der Social-Media-Auftritt eines rechtsextremen Politikers rein als politische Kommunikation zu betrachten, oder auch als Unterhaltung und somit Teil der Populärkultur? Je nachdem fällt die Antwort auf die Frage sehr unterschiedlich aus.
Ich hoffe, Popkultur ist gefährlich und bleibt es, denn zu ihren wichtigsten Funktionen gehört Kritik, Irritation und die Bewusstmachung von sozialen Zuständen und Missständen.
Ist Popkultur denn an sich gefährlich oder unschuldig?
Ich hoffe, sie ist gefährlich und bleibt es, denn zu ihren wichtigsten Funktionen gehört Kritik, Irritation und die Bewusstmachung von sozialen Zuständen und Missständen. Eine gezähmte und streng reglementierte Popkultur könnte so etwas nicht erbringen. Andererseits ist Popkultur per se auch eine Leerstelle, in der verschiedenes Gedankengut – leider auch rechtsextremes – resonieren kann. Das lässt sich allenfalls durch Zensur verhindern oder ein Verbot von bestimmten Symbolen. Die Zivilgesellschaft und der Gesetzgeber müssen hier die Grenzen verhandeln. Es darf jedoch nicht vergessen werden: Popkultur ist oft unangenehm und unappetitlich, aber erst, wenn diese Grenzen überschritten sind, müssen wir – mit gutem Recht – als Gesellschaft alarmiert sein.
Provokation wird oft mit Punk, Metal und Rap verbunden, „Pop“ dagegen mit dem Mainstream. Inwiefern trägt es zur Normalisierung rechtsextremen Gedankenguts bei, wenn dieses sich ausgerechnet in der Popkultur findet?
Ich bevorzuge einen Begriff von Popkultur, der die sogenannten Subkulturen, wie Punk, Metal und Rap, miteinbezieht. Zu stark sind die gegenseitigen Beeinflussungen und Überlappungen, als dass ich eine klare Trennung zwischen Mainstream und Subkultur ziehen möchte.
Doch ganz gleich, ob es sich um Hardrock, Radio-Pop oder Schlager handelt: Die Präsenz von politischem und extremistischem Gedankengut in popkulturellen Formaten trägt zur Verbreitung und ja, auch zur Normalisierung dieser Inhalte bei. Denn Popkultur ist öffentlich. Und Standpunkte, die öffentlich vertreten werden, gewinnen dadurch den Anschein, auch „vertretbar“ zu sein – sogar dann, wenn diese Positionen in Wahrheit weder moralisch noch rechtlich legitimiert sind.
Popkultur kann Wahlverhalten unmittelbar beeinflussen
Inwiefern kann diese popkulturelle Öffentlichkeit Wahlerfolge beeinflussen?
Ganz grundsätzlich machen Musik, Filme und Social Media politische Positionen und Botschaften bekannt und zugänglich. Die Popkultur spielt zudem eine große Rolle im Kontext von Wahlkämpfen, und zwar schon immer: Die Rockband „The Allman Brothers“ unterstützte 1976 den späteren US-Präsidenten Jimmy Carter im Wahlkampf, genauso wie Bela B, der Schlagzeuger von „Die Ärzte“, sich 2021 öffentlich für die Grünen aussprach.
Und auch, wenn die Künstlerinnen und Künstler nicht immer explizite Wahlempfehlungen machen, lassen viele doch eine politische Richtung erkennen. Dies kann einen wichtigen meinungsbildenden Effekt bei Fans haben – und womöglich auch in anderen Bevölkerungsteilen.
Popkultur kann Wahlverhalten unmittelbar beeinflussen. Unabhängig von der politischen Richtung ist häufig auch zu beobachten, dass Pop-Größen dazu aufrufen, überhaupt zur Wahl zu gehen. Es kann also auch ein Zusammenhang zwischen Popkultur und Wahlbeteiligung angenommen werden.
Und welchen Einfluss hat Tiktok?
Die Tiktok-Profile arbeiten stark mit popkulturellen Bezügen und Formaten und selbstverständlich tragen sie dazu bei, radikale politische Positionen unter den jungen Wählern zu verbreiten. Für viele ist dies eine Form der Unterhaltung. Hinzu kommen Social-Media-Algorithmen, die themenverwandte Inhalte vorschlagen – darunter auch im engeren Sinne popkulturelle Formate, wie Musikvideos rechter und rechtsextremer Interpreten oder Inhalte rechter Influencerinnen und Influencer.
In einem solchen Kommunikationsumfeld in sozialen Medien kann ein Einfluss auf die Wahlabsichten also durchaus angenommen werden. Doch inwieweit sich damit das konkrete Wahlverhalten der unter 25-Jährigen erklären lässt, und welchen Einfluss welche Elemente populärer Kultur daran haben, ist eine Frage, die die Wahlforschung noch genauer wird beantworten müssen.
Die Tiktok-Profile arbeiten stark mit popkulturellen Bezügen und Formaten und selbstverständlich tragen sie dazu bei, radikale politische Positionen unter den jungen Wählern zu verbreiten.
Wie groß ist eigentlich der Graben zwischen breiter Öffentlichkeit und der Welt der sozialen Medien? Zum Beispiel erfuhren viele Menschen erst spät davon, dass die Sylter Kombination von „l‘amour toujours“ und rassistischem Text in einer Reihe von Partyvideos stand, die online seit Monaten geteilt worden sind.
Es gibt einen Trugschluss in der Betrachtung von Social Media, nämlich den, dass es sich bei den Sozialen Medien um einen Spiegel der Gesellschaft handelt. Das ist nicht der Fall. Allenfalls partiell bilden die sozialen Medien einen Resonanzraum, in dem gesamtgesellschaftliche Phänomene nachhallen. Doch eigentlich funktionieren beide Sphären nach verschiedenen Logiken und Dynamiken, haben andere Akteure und Strukturen. Es gibt Überlappungen, aber es darf einen nicht wundern, dass es zu Ungleichzeitigkeiten kommt. Deswegen muss man auch vorsichtig sein, von der einer Sphäre unmittelbar auf die andere zu schließen.
Auf Volksfesten wie der Travemünder Woche oder dem Oktoberfest darf der Partyhit von Gigi d‘Agostino nicht mehr gespielt werden. Was halten Sie von solchen Verboten?
Aus Sicht der Veranstalter kann ich ganz klar nachvollziehen, wenn man sagt: „Lieber nicht, lieber DJ, spiel es besser nicht.“ Doch auch eine andere Perspektive ist denkbar: Gerade jetzt herrscht eine große Sensibilität für diesen Song und seine Verfremdung. Es bleibt abzuwarten, was auf der nächsten Party geschieht, auf der er gespielt wird und – falls es passiert – erneut fremdenfeindliche Parolen zu hören sind. Es wäre zumindest denkbar, als Veranstalter zu sagen: „Vielleicht haben die Leute etwas gelernt.“ Vielleicht wird die Zivilgesellschaft diesmal eingreifen. Unterschätzen sollten wir sie nicht.
Es gibt einen Trugschluss in der Betrachtung von Social Media, nämlich den, dass es sich bei den Sozialen Medien um einen Spiegel der Gesellschaft handelt.
Sie rechnen mit einem Widerstand der feierfreudigen „party people“?
Es ist durchaus denkbar, dass sich Musikfans zusammenschließen und sagen: „Das ist ein Welthit, zu dem wir auch in Zukunft tanzen wollen, den lassen wir uns nicht von euch nehmen!“ Unter Umständen kann man den Song daher ganz bewusst auch weiterhin spielen, gerade um ihn nicht den Rechtsextremen zu überlassen. Ein politisches und zivilgesellschaftliches Ringen um und mit Symbolen der Popkultur kann in verschiedene Richtungen gehen.
Warum sollte die Zivilgesellschaft an dieser Stelle nicht so wehrhaft sein, wie es die Bundesrepublik insgesamt für sich selbst als Anspruch formuliert?
Dieser Text gehört zur Wochenend-Edition auf ksta.de. Entdecken Sie weitere spannende Artikel auf www.ksta.de/wochenende.