Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen über das Zuhören in Zeiten der Krisen und sozialen Medienmacht.
Soziale Medienmacht„In Björn Höckes Welt will ich nicht leben“

Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen bei der Digitalmesse Re:publica (Archivbild)
Copyright: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Herr Professor Pörksen, kaum ein Begriff ist gesellschaftlich gerade so strapaziert wie das Zuhören. Auch Ihr neues Buch handelt davon. Wenn alle vom Zuhören reden – ist das nicht paradox?
Bernhard Pörksen: Stimmt. Charismatische Redner werden gefeiert, bekommen Applaus und Rhetorik-Preise. Ein Preis für gelingendes Zuhören ist mir nicht bekannt. Die Zuhörenden stehen im Schatten, und wenn ihnen mal jemand dankt, dann vielleicht in Form eines persönlichen Briefes, abseits der großen Bühne. Kurzum: Wir nehmen das Reden zu wichtig. Und wir unterschätzen das Zuhören, diese Supermacht der Kommunikation. Denn ohne das Zuhören ist alles nichts. Es gibt kein Gespräch, keine Debatte, keinen Streit, aber auch keine Versöhnung und im Letzten auch kein gesellschaftliches Miteinander.
Das steht in jedem Beziehungsratgeber.
Alles zum Thema Fridays for Future
- Zukunftswerkstatt 2039 In Wipperfürth ging’s um die regionale Ernährung in kommenden Zeiten
- Klimaprotest in Köln Fridays for Future ruft zur Demo am 21. März am Kölner Dom auf
- „Wähl Liebe“-Demo auf Neumarkt Tausende demonstrieren in Köln gegen Hass und für Vielfalt
- „Fridays For Future“ Mehrere Tausend Teilnehmer bei Klima-Demo in Köln anlässlich der Bundestagswahl
- Start auf dem Heumarkt Fridays For Future demonstriert am Freitag in Köln
- „ Vorwürfe und Enttäuschung zum Ende der Weltklimakonferenz in Baku
- COP29 in Baku Klimagipfel-Entwurf – 250 Milliarden Dollar Hilfen pro Jahr
Ist das so? Ich will jedenfalls mit diesem Buch raus der Psycho-, Kuschel- und Ratgeber-Ecke. Und dem Thema eine andere Ernsthaftigkeit zurückgeben. Fakt ist: Wir leben in Zeiten einer moralisierenden Sofortverurteilung – ohne Beachtung des Kontexts, der Vorgeschichte, der besonderen Situation. Für die Qualität eines Werturteils ist aber entscheidend, wie viel Zeit ich mir genommen habe, wie genau ich hingehört habe, wie sehr ich auf die Nuancen geachtet habe. Am Ende muss dann keineswegs immer ein akzeptierendes, gar liebendes Einverständnis stehen. Gutes Zuhören kann auch zu entschiedener Ablehnung führen.
Muss man allen und allem zuhören? Ich denke an Demagogen, Volksverhetzer, Reden voller rassistischer Tiraden…
Ich kann darauf keine allgemeine Antwort geben. Denn kommunikative Wahrheit ist immer konkret, situations- und rollenbezogen. Daher konkret: Sollten Sie als Journalist ein gefühlsduseliges Interview mit Alice Weidel führen? Keine gute Idee! Sollte dies ein Seelsorger tun, den eine AfD-Frau bittet, ihr zuhören? Unbedingt! Sollte ich mich als Wissenschaftler mit Björn Höcke auf ein Podium setzen? Auf gar keinen Fall.
„Daher setze ich mich auch nicht auf ein Podium mit ihm“
Warum nicht?
Weil ich mir seine Brandreden, seine Verächtlichmachung des Holocaust-Gedenkens, seine Attacken auf Andersdenkende sehr genau angeschaut habe. Ich will in der Gesellschaft, die sich ein Björn Höcke herbei phantasiert, nicht leben, keinen einzigen Tag. Es gehört zu meiner Verantwortung, dies sehr klar zu sagen. Und daher setze ich mich auch nicht auf ein Podium mit ihm.
Und wir als Zeitungsjournalisten sollten das so handhaben? Man sagt uns, das wäre undemokratisch, eine Art Zensur.
Der US-Journalist Andrew Revkin, der in der „New York Times“ als einer der ersten über die drohende Klimakatastrophe geschrieben hat, nennt das die „Tyrannei der Balance“. Ich denke: Man muss nach dem Muster eines denkfaulen „Er sagt, sie sagt“-Journalismus nicht allen Gehör schenken oder zum Gehörtwerden verhelfen. Noch einmal: Kommunikative Wahrheit ist stets konkret. Und mir scheint: Politische Journalisten sind zu oft als Theaterkritiker oder Sportkommentatoren unterwegs: Wer hatte die bessere Performance? Wie ist der Punktestand nach dem letzten Kanzlerduell? Wer hat wen wann getunkt? Das sind politikferne Perspektiven. Es steht längst zu viel auf dem Spiel.
Und stattdessen?
Wenn ich es noch einmal vom Zuhören her denke, dann geht es um die Frage: Wessen Standpunkt verdient Resonanz? Dafür muss man tatsächlich erst einmal genau hinhören, in der Tiefe zu verstehen suchen, was eigentlich gesagt wurde. Es gilt, auch dem Flüstern, dem Schweigen und dem Nichtgesagten hinterherzuhören. Um dann – etwa, wenn es um Extremismus geht – auch entschieden zu handeln.

Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen während der Medientage am in München.
Copyright: IMAGO/epd
Dann wäre Zuhören mehr als Reden?
Ja. Denn erst im Zuhören verstehe ich, in welcher Welt der andere wirklich lebt. Erst durch das Zuhören kann ich Gemeinsamkeiten entdecken, Kommunikationsbrücken entwerfen, aber auch das Trennende erkennen.
Sie vermissen ja einen Zuhör-Preis? Gäbe es ihn, wie würden Sie den Preisträger, die Preisträgerin ermitteln?
Das wird schwer. Aber ich für dieses Buch manchen Menschen viele Jahre lang zugehört. Und bin irgendwann tief beeindruckt und beschenkt wieder weitergezogen. Das ist die ehemalige Leiterin der Odenwaldschule, Margarita Kaufmann, oder der frühere Schulleiter am Canisius-Kolleg der Jesuitenpater in Berlin, Pater Klaus Mertes. Beide haben in einem entscheidenden Moment den von Missbrauch Betroffenen zugehört. Andrew Revkin hat als Klimareporter gemerkt, dass man die Verdrängung der Klimakrise mit Angstszenarien und Tugendpredigten eben gerade nicht überwindet. Und hat deshalb neue Wege der Aufklärung für sich entdeckt. Der frühere Gouverneur von Kalifornien Jerry Brown, vielleicht einer der erfolgreichsten US-Politiker der jüngeren Geschichte, hat schon in den 1970er Jahren ein ökologisches Gehör entwickelt. Warum?, habe ich mich gefragt. Wie ist ihm dies gelungen? Sehen Sie, ich selbst begreife am Beispiel, am konkreten Fall. Und diese Menschen haben verstanden, wie wie mächtig das Zuhören sein kann. Wer wirklich zuhört, der verändert die Spielregeln eines Systems fundamental.
Wir stehen unmittelbar vor einer Wahl, in der Klimakrise, Klimawandel und Klimakatastrophe kaum eine Rolle gespielt haben. Das Problem ist nicht verschwunden. Aber es war nicht die Rede davon, weil – so die Mutmaßung – viele nichts davon hören wollten. Wann und warum hört das Zuhören auf?
Gute Frage. 2024 war das Jahr mit den höchsten CO2-Emissionen in der Menschheitsgeschichte. Wir wissen, was das bedeutet. Wir wissen alles. Das ist das Rätsel der wissenden Ignoranz. Aber warum handeln wir nicht danach? Meine Antwort: Weil die Klimakrise das „perfekte Problem“ darstellt: hochgradig abstrakt, nur wissenschaftsvermittelt erfahrbar. Und gleichzeitig hoch emotional, geht es doch um Leben und Tod. Überdies gilt: Die Krise schleicht leise heran, in winzigen Schritten, ist also mediendramaturgisch gesehen der totale Abtörner. Es gibt Rest-Unsicherheiten. Und gleichzeitig gilt: Wir müssen jetzt handeln, so dass in der Zukunft Effekte eintreten, die wir selbst aber womöglich gar nicht mehr erleben werden. Das ist schwer. Denn wir Menschen sind Wesen der Gegenwart.
Und jetzt?
Es gibt kein Fertigrezept. Und doch: Bei meinen Recherchen bin ich immer wieder auf einen vielversprechenden und erfolgreichen Ohrenöffner gestoßen: den vertrauenswürdigen Botschafter. Das war aus meiner Sicht auch das Wirkungsprinzip, nach dem „Fridays for Future“ viele Menschen zum Zuhören gebracht hat: Wenn der Enkel den Großeltern sagt, so können wir, so dürfen wir nicht weiterleben – dann ist das die vielleicht wirkungsvollste Form der Beeinflussung überhaupt, weil die Großeltern den Überbringer der Botschaft auf keinen Fall verlieren wollen.
„Was wir für den Klimaschutz tun, muss lukrativ sein“
Corona und Krieg haben die Stimme von „Fridays for Future“ dann schon wieder ziemlich heruntergedimmt.
Um neu Gehör zu finden, wird es zusätzlich eine andere Erzählung brauchen, den Versuch der „großen Lösung“: Was wir für den Klimaschutz tun, muss lukrativ sein, kooperativ und nicht konfrontativ, darf nicht sozial ungerecht sein, sollte idealerweise sogar Spaß machen.
Alles das, was sich zum Beispiel mit dem Heizungsgesetz nicht verbunden hat.
Stimmt. Wenn wir nach Dänemark blicken, dann sehen wir, dass eine eigentlich geniale Heiztechnologie dort eine ganz andere Akzeptanz genießt und in einer ganz anderen Geschwindigkeit eingesetzt wird. Und zwar deshalb, weil man dort darüber nachgedacht hat: Wie fördert man Zustimmung für die ökologische Transformationen? Zum Beispiel, indem man zeigt: Diese Technologien sind billiger, ressourcenschonender, und sie nützen allen. Die Angsterzählung, die Attacke auf das Individuum, das sich partout nicht an die eigene Idee einer besseren Welt halten will – all das erzeugt im Zweifel Abwehr- und Weghör-Reflexe.
Im ersten TV-Duell der Kanzlerkandidaten hat Friedrich Merz mehrfach zu Olaf Scholz gesagt: Sie leben nicht in dieser Welt. In voneinander getrennten Welt kann es kein Zuhören geben. Liegt hier vielleicht das Problem?
Ich habe Merz‘ Äußerungen weniger als Kommunikationsanalyse gedeutet, denn als populistische Rhetorik auf der Zielgeraden des Wahlkampfs. Es gehört zum Repertoire des Populisten, sich als jemand zu empfehlen, der „auf Volkes Stimme hört“. Populismus ist, so könnte man sogar sagen, simuliertes Zuhören bei gleichzeitiger Errichtung von Zuhörblockaden: Die Verfeindungslust der Populisten, ihre Verzerrungen, ihre Attacken auf Andersdenkende und Anderslebende – all dies erschwert das Miteinander-Reden und das Einander-Zuhören.
Die Populisten selbst finden aber sehr wohl Gehör mit ihren Parolen – denken Sie nur an Donald Trump, der alles macht, nur keine Politik für das Volk. Wieso funktioniert das?
Weil Leute wie Trump die Ursehnsucht von Menschen danach bedienen, gehört und verstanden zu werden.
Hauptsache das Gefühl, ich werde gehört – egal was daraus folgt?
Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen: Das Zuhörversprechen ist der entscheidende Grund für den Erfolg von Populisten. Aber sie treffen damit einen Punkt.
„Die sozialen Medien sind Instrumente einer gigantischen Resonanzsimulation“
Das passt zu dem, was Sie verschiedentlich über die sozialen Medien geschrieben haben. Der Wunsch nach Gehör geht dort nur für ganz wenige in Erfüllung. Die meisten finden mit ihrer Stimme im Netz kein Echo – und „Echolosigkeit verbittert“, sagen Sie.
Absolut. Mehr noch: Die sozialen Medien sind Instrumente einer gigantischen Resonanzsimulation. Und doch: Das digitale Zeitalter schillert. Es eröffnet unendlich vielen Menschen die Möglichkeit, zu publizieren, zu posten, zu kommentieren, sich einzuschalten, mitzumischen – und zugleich konzentrieren sich die Macht und der Reichtum in der Hand von einigen wenigen digitalen Feudalherrschern wie Elon Musk. Öffnung und Schließung, Partizipation und Vermachtung – das ist das digitale Paradox.
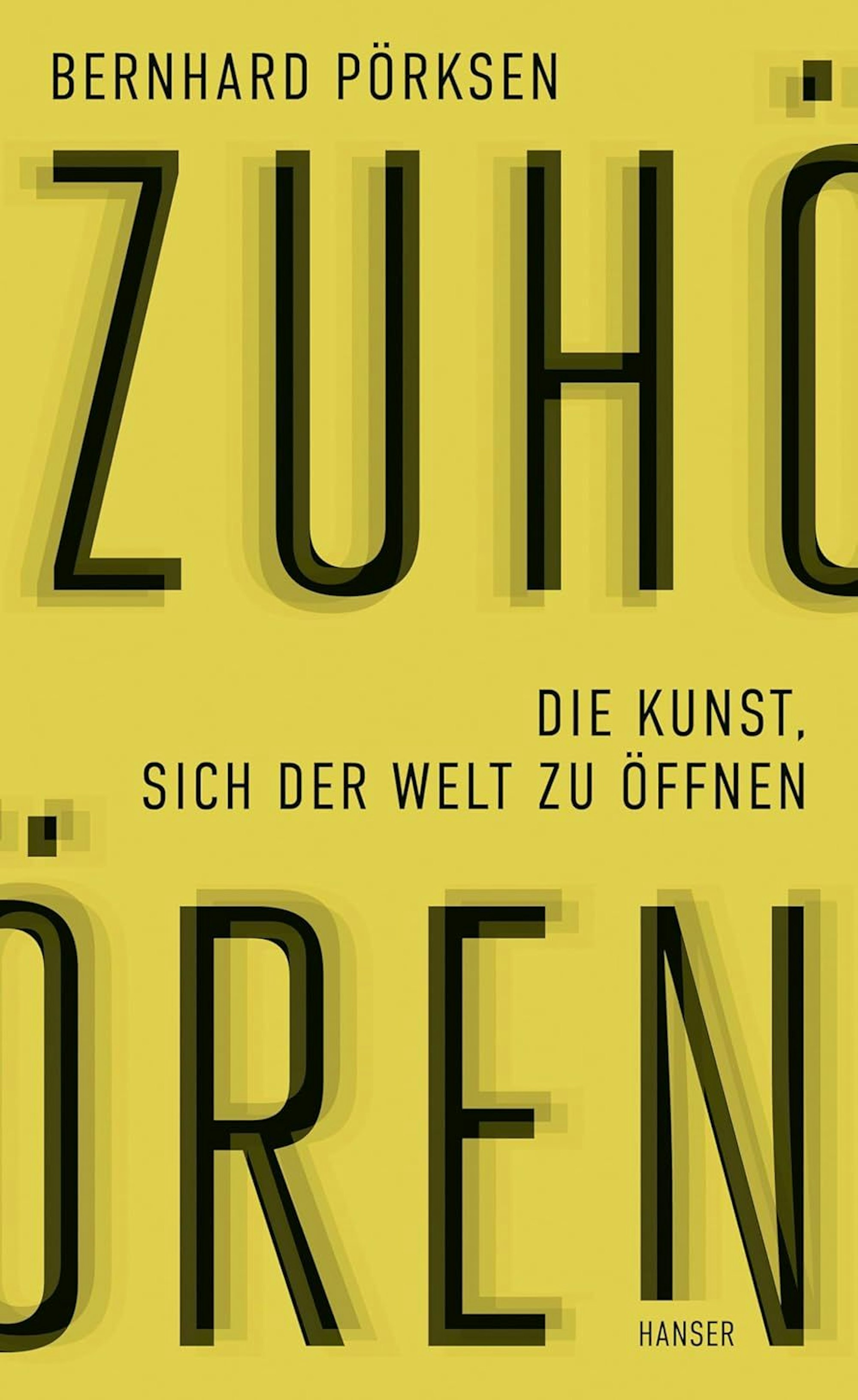
Bernhard Pörksens neues Buch „Zuhören. Die Kunst, sich der Welt zu öffnen“ ist soeben im Verlag Hanser erschienen. 330 Seiten, 24 Euro.
Copyright: Hanser
Mit einer „Politik des Zuhörens“ wird man dem nicht beikommen.
Nein. Wichtiger schiene es mir, die Fehlanreize der sozialen Medien in Richtung von Krawall, Empörung, Entrüstung einzudämmen. Es ist offensichtlich, dass sich zivile Kommunikation unter diesen Bedingungen nicht ausreichend entfalten kann. Ich war viele Jahre im Silicon Valley unterwegs, habe hier die allerersten Online-Gemeinschaften der Welt studiert. Das waren Computer-Hippies, die sich im Hafen von Sausalito zusammenfanden und die ersten Online-Netzwerke geknüpft haben.
Was haben Sie von denen gelernt?
Ich bin hier – so scheint mir – auf das Zivilitätsgeheimnis vernetzter Kommunikation gestoßen: Es gab in diesen ersten Online-Gemeinschaften keine Anonymität, es gab keine Werbung, alles wurde über geringe Abo-Gebühren finanziert. Die Gemeinschaften waren stets relativ klein und vergleichsweise homogen – mit maximaler Redefreiheit bei gleichzeitig intensiver Moderation. All dies hat eine andere Ökologie der Informationen entstehen lassen. Nebenbei: Mir ist es gerade in unseren dystopischen Zeiten wichtig, nicht nur Klagelieder zu anzustimmen, sondern eben auch Alternativen des Denkens und Handelns vorzuführen. Und das wäre eine – diese Vertrauensgemeinschaften aus der Frühphase der Netzkultur wiederzuentdecken und zu erkennen: Nichts ist alternativlos.
Sie meinen tatsächlich, damit könnte man gegen die Online-Giganten antreten?
Zumindest liegt darin eine gedankliche Spur. Natürlich braucht es dazu eine Bildungsanstrengung, die Medienmündigkeit auf der Höhe der digitalen Zeit trainiert. Natürlich braucht es eine Diskursanstrengung in der Breite der Gesellschaft, die auch sichtbar macht, wie gewaltig die Desinformationsschäden bereits heute sind. Natürlich braucht es auch eine sorgsam austarierte Regulierungsanstrengung. Aber im Kern bin ich davon überzeugt: Desinformation ist mächtig. Doch mächtiger noch ist die Utopie der Vernetzung. Und die ist nach wie vor lebendig, sie lebt.
Bernhard Pörksen, geb. 1969, ist Professor für Medienwissenschaften an der Universität Tübingen.

