Bei Robert Habeck klingt alles nach einem Rückzug aus der Politik. Dabei wird sein konstruktiver Stil noch gebraucht.
Grünen-KandidatFür einen Abschied von Robert Habeck gibt es keinen Grund
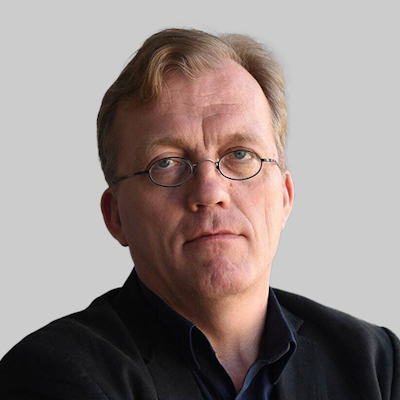

Robert Habeck nach der Wahlniederlage in der Bundespressekonferenz.
Copyright: Carsten Koall/dpa
Leute, die Robert Habeck gut kennen, prophezeiten bereits vor Monaten, dass sich der grüne Kanzlerkandidat im Falle einer Wahlniederlage aus der Politik zurückziehen werde. Insofern ist die Ankündigung des 55-Jährigen, der erst mit Anfang 30 in die Politik ein- und dann rasch aufstieg, keine Überraschung. Dass aus der Prophezeiung nun Realität wird, ist bedauerlich – aber nachvollziehbar.
Bedauerlich ist sie, weil Habeck ein großes politisches Talent besitzt. Er ist nicht allein rhetorisch stark und kann Menschen begeistern. Er hat vor allem die gängigen politischen Rituale infrage gestellt, bei denen allzu oft eines noch wichtiger ist als die Lösung von Problemen: der Nutzen der eigenen Partei. Dem scheidenden Vizekanzler kommt überdies ein enormes Verdienst zu: die Deutschen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine vor einer Energiekrise bewahrt zu haben. Keine Heizung blieb kalt. Dafür gebührt ihm Dank.
Robert Habeck wirkte zu nachgiebig
Trotzdem ist die grüne Wahlschlappe kein Zufall, sondern in gleicher Weise Folge des Habeck‘schen Politikansatzes. Denn er hat Kompromissbereitschaft im Verfahren zu selten mit Entschiedenheit in der Sache verbunden. So entstand sowohl in der eigenen Partei als auch bei Wählerinnen und Wählern der Eindruck zu großer Nachgiebigkeit. Das Erstarken der Linken ist die Quittung dafür. Problematisch war nicht, dass der grüne Kandidat die Tür für eine schwarz-grüne Koalition bis zum Schluss offenhielt. Problematisch fanden viele das Gefühl, er werde auf jeden Fall hindurchgehen.
Alles zum Thema Deutscher Bundestag
- Politische Zukunft unklar Robert Habeck will Berichten zufolge Bundestagsmandat niederlegen
- Wahleinsprüche Bereits 800 Einsprüche gegen Bundestagswahl
- „Aus gesundheitlichen Gründen“ Altkanzler Gerhard Schröder gibt Gerichtsstreit um Büro auf
- Regierungsbildung Merz soll am 6. Mai zum Kanzler gewählt werden
- Konstruktiv und normalisiert AfD plant neue Taktik im Bundestag – Eine Fraktion wie jede andere?
- „Maxton Hall“-Star Damian Hardung rechnet mit der AfD ab
- Bundestag „Wie mit jeder anderen Oppositionspartei“ – Spahn für anderen Umgang mit AfD
Die Ursachen dafür liegen wiederum tiefer. Eine Ursache ist, dass Habeck kulturell links wirkt, aber politisch nicht links tickt. Eine weitere Ursache ist Habecks Selbstbild. Er sieht sich als Versöhner, der Brücken schlägt. Das war in Schleswig-Holstein so und setzte sich auf der Bundesebene fort. Der Mann mit gelegentlichen handwerklichen Schwächen, der Sympathien wie Antipathien weckt, scheut den Konflikt. Dadurch geht Kontur verloren und die Klarheit dessen, was er eigentlich will.
Habeck sprach gezielt das bürgerliche Lager an
In der sehr konkreten Wahlkampfsituation kommt hinzu, dass Habeck gezielt das bürgerliche Lager ansprach. Dies begann mit dem Versuch, seine Parlamentarische Staatssekretärin Franziska Brantner zur Wahlkampfmanagerin zu machen. Denn Brantner, die anschließend eher ungewollt Parteivorsitzende wurde, ist in einer Partei äußerst beliebt: in der CDU. Ein ähnliches Signal war Habecks Rückkehr zu der bei den Linken mittlerweile verpönten Plattform X – und der Umstand, dass er seinen migrationskritischen Zehn-Punkte-Plan in der „Bild“-Zeitung platzierte.
In der Wahlkampagne kam Klimaschutz bis auf die Endphase nur als Instrument einer gelungenen Wirtschaftsförderung vor – und die im Wahlprogramm erhobene Forderung nach einer humanitären Flüchtlingspolitik gar nicht. Zugleich beschränkte Habeck Angriffe auf den Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz auf einen Punkt: den Hinweis, dass dessen Finanzpolitik unseriös sei.
Das Misstrauen gegenüber Habeck und seinem mittigen Kurs war mithin längst da, bevor Merz ansetzte, im Bundestag eine Verschärfung der Migrationspolitik notfalls mit Stimmen der AfD durchzudrücken. Von Anfang an war ja kaum zu vermitteln, warum ausgerechnet die Grünen, von denen viele Angela-Merkel-Fans sind, mit einer Union koalieren sollten, die sich mit Merz deutlich konservativer präsentiert.
Ein unauflösbares Paradox für die Grünen
Jetzt entstand auch noch die absurde Situation, dass die Parteispitze mit Hunderttausenden gegen Merz‘ Migrationswende auf die Straße ging und gleichzeitig eine Koalition mit ihm weiterhin nicht ausschloss. Dabei hieß es sogar hinter den Kulissen, man traue Merz nicht. Das Paradox ließ sich niemandem mehr erklären.
Das so entstandene Glaubwürdigkeitsvakuum hat die Linke mit ihrem „Alle wollen regieren, wir wollen verändern“ geflutet. Robert Habeck wirkte auf progressive Wähler wie ein Rückraumspieler in seiner Lieblingssportart Handball, der links antäuscht und rechts vorbeigeht. Es hätte dagegen ein Mittel gegeben: das unmissverständliche Signal, dass man mit der Union zumal aus staatspolitischen Gründen zusammenarbeiten würde, aber nicht um jeden Preis. Doch dazu waren der Machtwille und der Ehrgeiz zu groß. Mit beidem sind die Grünen am Wahltag an Grenzen gestoßen.
Das alles wiederum ändert nichts daran, dass Robert Habeck etwas sehr Wertvolles in die Politik eingebracht hat: Konstruktivität. Davon könnte die Republik im Zeitalter des Populismus fürwahr mehr gebrauchen.

