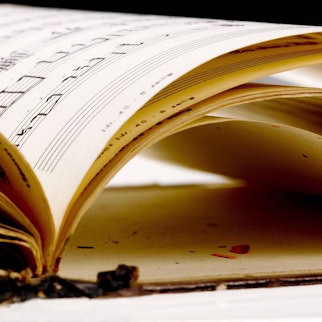Das Eröffnungskonzert des Acht-Brücken-Festivals in der Kölner Philharmonie geriet allzu gefällig. Das WDR Sinfonieorchester spielte unter Cristian Măcelaru.
Acht-Brücken-Festival in KölnMusik auf dem romantischen Holzweg

Nicola Benedetti, italienische Violinistin auf dem Acht-Brücken-Eröffnungskonzert
Copyright: Jörn Neumann
Niederschwelligkeit ist nahezu ein Zauberwort geworden, wenn darüber diskutiert wird, wie man denn wohl ein breites Publikum auch für Angebote aus der obersten Etage der Hochkultur gewinnen kann. Auf dieser Etage ist traditionell die Neue Musik angesiedelt, deren Exponenten es sich vor Jahrzehnten noch als Ehre anrechneten, vor leeren Reihen spielen zu dürfen.
Dass sich das im Zeichen eben der geforderten Niederschwelligkeit geändert hat, zeigte jetzt das Eröffnungskonzert des Kölner Acht-Brücken-Festivals mit dem WDR Sinfonieorchester unter Cristian Măcelaru in der Philharmonie. Daran „schuld“ war nicht nur die humorige Moderation von Martin Zingsheim, der es schaffte, sogar György Ligetis „Atmosphères“ wie einen Karnevalshit anzukündigen, sondern vor allem das Hauptwerk des Abends: das Violinkonzert des Briten Mark Simpson (Jahrgang 1988), das hier in Anwesenheit des Komponisten in deutscher Erstaufführung erklang.
Ist das überhaupt noch Neue Musik?
Die Frage, ob es sich dabei überhaupt um Neue Musik handelt, darf mit Fug und Recht gestellt werden. Zweifellos ist ein Werk, das ausweislich des Programmheftes die Leiden der Corona-Krise genauso wie ihre Überwindung musikalisieren soll, in einem äußerlichen Sinn „neu“. Aber ist es dies auch in einem inneren Sinn, in Ausdruck, Technik, Handhabung der musikalischen Mittel?
Alles zum Thema Kölner Philharmonie
- Daniel Lozakovich in Köln Mit gesunder Virtuosen-Attitüde durch einen unbequemen Solopart
- Philharmonie Köln Bei Nina Stemme kommt das Wesentliche von innen
- Rotterdam Orchestra in der Kölner Philharmonie Stardirigent ließ Bruckners Garten üppig erblühen
- Víkingur Ólafsson in der Kölner Philharmonie Höchstes Niveau mit theatralischen Einlagen
- lit.Cologne 2025 Warum sich Schauspieler Hans Sigl als Feminist sieht – und Blumenschenken trotzdem dazu gehört
- Kölner Kammerkonzert Magische Schwerelosigkeit mit Mozart
- Kölner Philharmonie Das bieten die Meisterkonzerte der nächsten Saison
Nein, das ist es in diesem Fall entschieden nicht. Simpson betreibt ganz offenkundig ein Revival des romantischen Virtuosenkonzerts, bei dem gute alte Bekannte von Paganini über Mendelssohn bis zu Max Bruch einander die Hände reichen. Süffige Melodien, schmelzende Doppelgriff-Terzen und -Sexten, ein kaum angekränkeltes Dur und Moll, ein völlig ungebrochenes Espressivo – an diesem Framing konnten auch die Eruptionen des groß besetzten Orchesters nichts ändern. Dessen stärkstens geforderte Schlagzeuggruppe überzog den Saal immer wieder mit Klanggewittern, deren Sinnhaltigkeit indes fraglich ist.
Violinistin Nicola Benedetti wurde frenetisch gefeiert
Nicola Benedetti, die italienische Solistin, musste man bei all dem nicht zum Jagen tragen. Sie freute sich offensichtlich, hier mal wieder ein richtig zirzensisches Stück vor sich zu haben. Sie bewältigte es mit stupender Technik, starkem, großem Ton und einem dezidiert romantischen Ausdrucksgestus, der der Faktur der Musik keinerlei Widerstände entgegensetzte. Wofür sie am Ende auch frenetisch gefeiert wurde.
Ja, das war tatsächlich eine niederschwellige Offerte – die freilich nicht die Frage erübrigt, um welchen Preis sie ergeht. Und da ist leider Skepsis angesagt: Eine aktuelle Musik, die so klingt, als sei seit dem 19. Jahrhundert nichts geschehen, ist ganz offensichtlich auf dem Holzweg. Um das festzustellen, muss man kein vergrätzter Adorno-Jünger sein.
Die beiden vorher aufgeführten Klangflächen-Kompositionen des 2023er Jubilars György Ligeti zeigten hingegen eindrucksvoll, dass es Neue Musik gibt, die auch im Abstand der Jahrzehnte „neu“ bleibt, nicht veraltet. Neben „Atmosphères“ erklangen „Clocks and Clouds“, wo durch den mitwirkenden Frauenchor (hier den WDR-Chor) ein nach wie vor faszinierendes instrumental-vokales Klangkontinuum entstand.
Für die dazwischen gespielte, teilweise als Trompetenkonzert einherkommende Kosmos-Komposition „Orion“ des 1983 in Paris ermordeten Franco-Kanadiers Claude Vivier gilt das in geringerem Maße – da wird einiges kurzgeschlossen, was nicht zusammenzupassen scheint: Obertonreihen, Tritonus-Bildungen und ein großer feierlicher Sound. Dazwischen unvermittelt eine triviale, ja ordinäre Volkslied-Anmutung im schunkelnden Dreiertakt. Nun ja.
Als „Opener“ des Festivals dürfte dieses Konzert seiner mutmaßlichen Funktion gerecht geworden sein. Es wäre allerdings fatal, wenn es in diesem Gusto weiterginge. Dagegen spricht freilich einiges – darunter das Werk der Porträtkomponistin Rebecca Saunders.